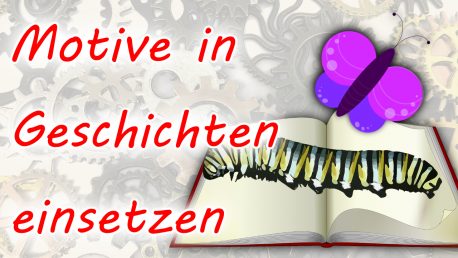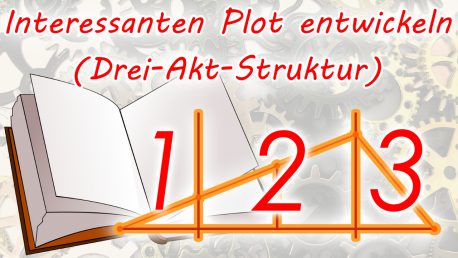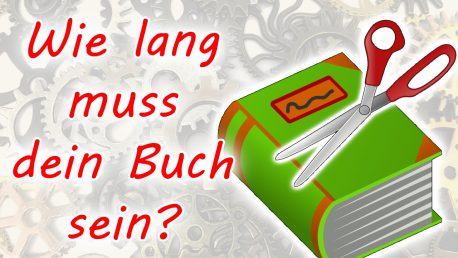Welches Genre hat Dein Roman?
Über Jahrtausende hinweg erzählen sich die Menschen immer die gleichen Geschichten. Und trotzdem sind diese Geschichten einzigartig. Nur gehören sie eben zum selben Genre. Dabei sind Genres so wandlungsfreudig, dass mittlerweile ein regelrechtes Chaos von Sub‑, Zwischen- und Nischengenres herrscht. Wie soll man als Autor da also durchblicken und das richtige Genre für die eigene Geschichte bestimmen? Das besprechen wir in diesem Artikel.