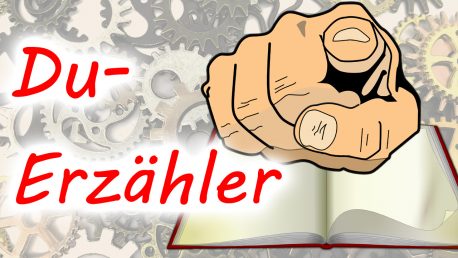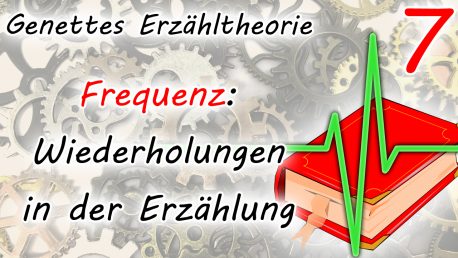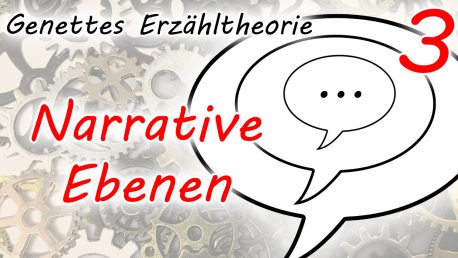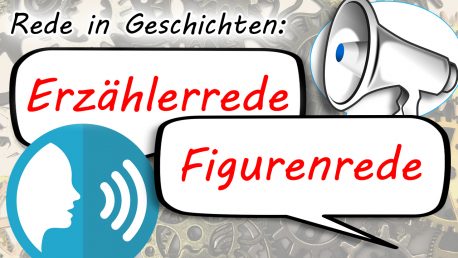Erzählen in der 2. Person: „Du-Perspektive“ bzw. „Du-Erzähler“
Kann man den Leser zum Protagonisten der Handlung machen? Schließlich dienen doch viele Geschichten dem Eskapismus und entführen den Leser in ein alternatives Leben. In der Regel funktioniert das durch Empathie bzw. das Hineinversetzen in eine fiktive Figur. Aber kann man den Leser nicht auch direkt in die Geschichte holen? Mit einem „Du-Erzähler“? In diesem Artikel reden wir über den Sinn und Unsinn dieser Erzählweise.