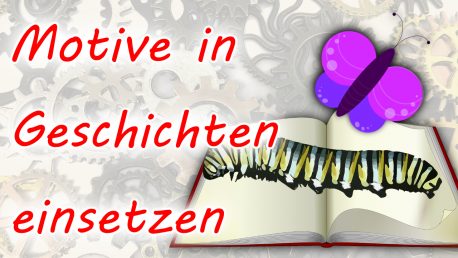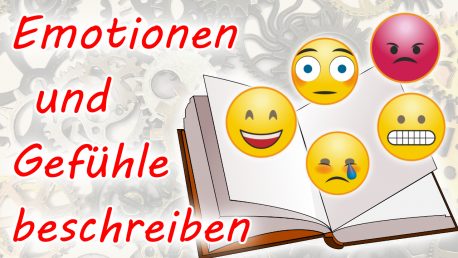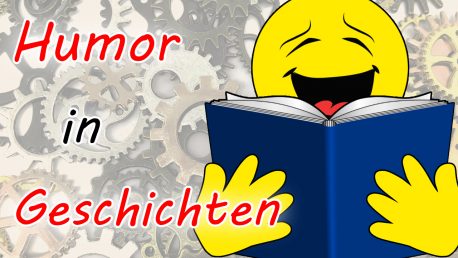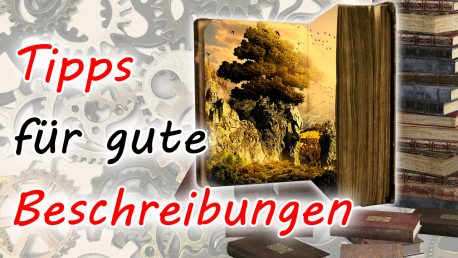7 Klischees, die ich liebe
Meistens wird davon gesprochen, dass Klischees unbedingt vermieden werden sollten. Doch man kann mit ihnen auch arbeiten. Man kann sie sogar lieben. Deswegen verrate ich in diesem Video ein paar meiner persönlichen Favoriten …