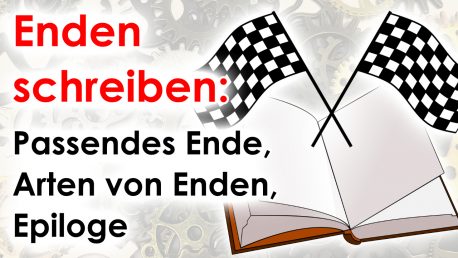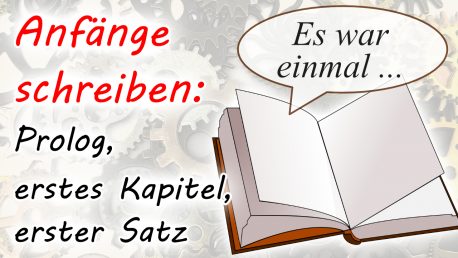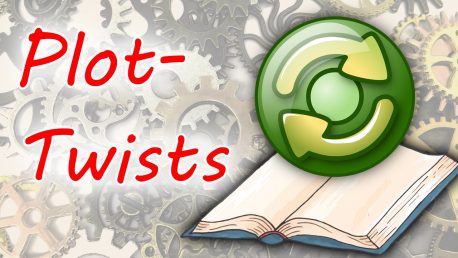Zeitebenen beim Erzählen: Die deutschen Zeitformen und wie man sie benutzt
Autoren spielen gerne mit Sprache. Doch besonders beim Erzählen von fiktionalen Geschichten wird es kompliziert: Mehrere Zeitebenen müssen in ein Verhältnis gebracht werden. Die Wahl bestimmter Zeitformen in unterschiedlichen Kontexten und Situationen erzeugt dabei feine Unterschiede. Deswegen besprechen wir in diesem Artikel, wann man welches Tempus benutzt, und bewundern einige Besonderheiten der deutschen Sprache.