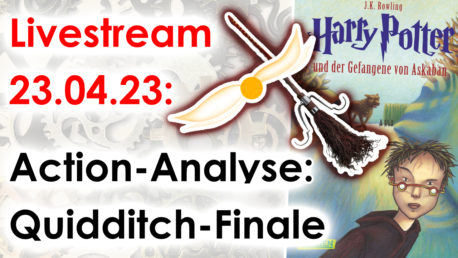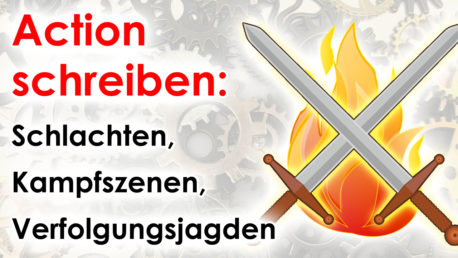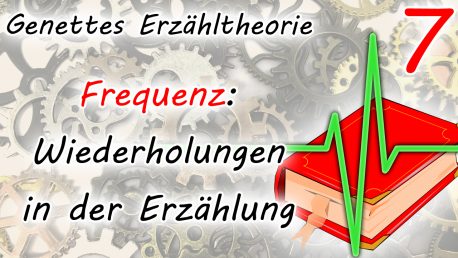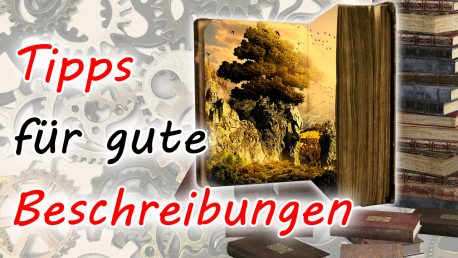Action-Szenen im Roman: Analyse des Quidditch-Finales in „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“
Vor einigen Wochen haben wir über das Schreiben von Action-Szenen gesprochen. Doch keine Theorie lehrt so gut wie die Praxis. Deswegen analysieren wir in diesem Livestream das Quidditch-Finale in Harry Potter und der Gefangene von Askaban: Wie ist die Szene strukturiert? Wie entsteht ein Gefühl von Dynamik? Wie wird Spannung erzeugt? Wir reden über all das und mehr …