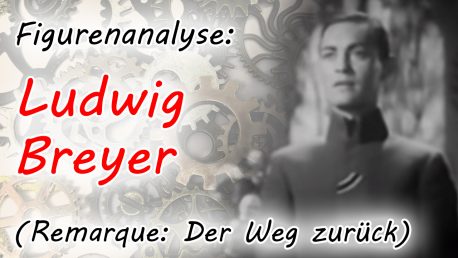Astrologie als Tool für das Erschaffen von Figuren
Viele Autoren benutzen die 12 astrologischen Tierkreiszeichen gerne für das Erschaffen von Figuren. Doch Astrologie ist in Wirklichkeit so viel mehr als eine bloße Persönlichkeitstypologie: Sie kann helfen, die Figuren und ihre Beziehungen untereinander vielschichtig zu gestalten. Wie das geht, erfährst Du in diesem Artikel.