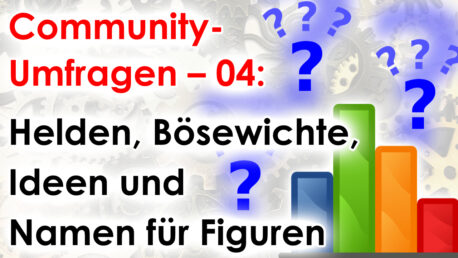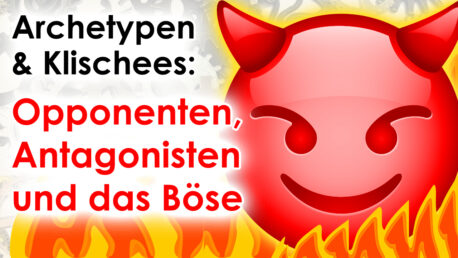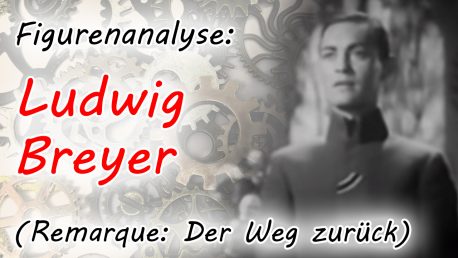Helden, Bösewichte, Ideen und Namen für Figuren
Mögen wir lieber Helden oder Bösewichte – und warum? Woher nehmen wir die Ideen für unsere Geschichten und auch für die Namen unserer Figuren? Um diese Umfragen dreht sich der heutige Rückblick auf unsere früheren Community-Diskussionen.