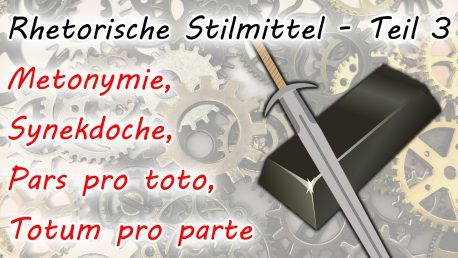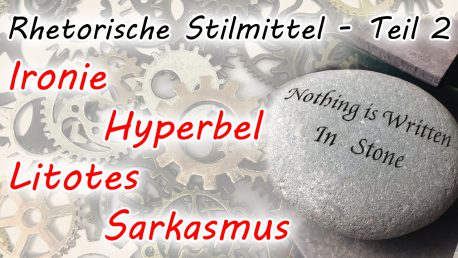Handlung aufbauen: Story vs. Plot
Wer eine Geschichte schreibt und eine interessante Handlung aufbauen möchte, muss sich bewusst machen: Story und Plot sind zwei verschiedene Paar Schuhe! Die Abgrenzung der beiden ermöglicht unter anderem spannende Spielereien wie anachronistisches und unzuverlässiges Erzählen. In diesem Artikel lernst Du diesen wichtigen Unterschied kennen.