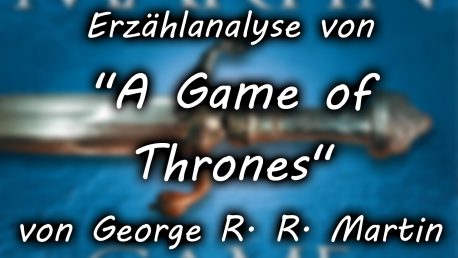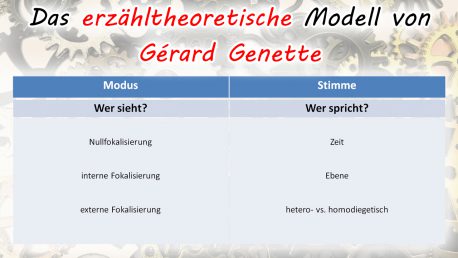Erzähltempo: Erzählzeit und erzählte Zeit
Egal, ob man ein Buch liest oder schreibt, das Erzähltempo spielt immer eine Rolle. Durch unterschiedliche Verhältnisse von Erzählzeit und erzählter Zeit kann der Autor vor allem mit Zeitraffung, Zeitdeckung und Zeitdehnung spielen. In diesem Artikel erfährst Du, was es mit diesen Zeitspielereien auf sich hat.