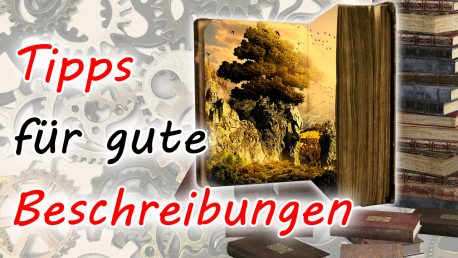Mit Beschreibungen tun sich viele Autoren schwer. Denn sie können sowohl schön als auch langweilig ausfallen. Damit bergen beschreibende Passagen immer ein gewisses Risiko. Was macht gute Beschreibungen also aus und wie schreibt man sie? In diesem Artikel teile ich einige Ideen.
Die Folien für dieses Video gibt es für Steady-Abonnenten und Kanalmitglieder auf YouTube als PDF zum Download.
Sie lassen uns staunen oder die Flucht ergreifen. Sie erschaffen Atmosphäre oder zerstören sie. Gute Beschreibungen sind eine verdammt hohe Kunst.
Wie schreibt man sie also? Was müssen wir beachten? Wie viele Beschreibungen sind gut und ab wann sind sie Gift? Wie bekommt man beim Beschreiben einen guten Stil hin? Und was tut man, wenn einem keine Details zum Beschreiben einfallen?
Das alles und noch viel mehr in diesem Artikel!
Was ist eine gute Beschreibung?
Beschreibungen existieren, weil wir manchmal im Kopf des Gegenüber ein Bild erzeugen möchten. Wir Schreiber beispielsweise wollen, dass unser Leser vor seinem geistigen Auge möglichst dasselbe Bild hat wie wir selbst. Wir wollen Kopfkino erzeugen, Atmosphäre erschaffen, Gefühle hervorrufen.
Und damit liegt die Definition einer guten Beschreibung klar auf der Hand:
Eine gute Beschreibung erfüllt ihren Zweck.
Sie erzeugt Kopfkino, erschafft Atmosphäre und weckt Gefühle.
Wie erreicht man das also?
Tipps und Techniken
In der Kürze liegt die Würze
Ohne viel Umschweife:
Die besten Beschreibungen sind kurz, knackig und treffen den Nagel auf den Kopf.
Du musst kein hyperdetailliertes Bild zeichnen. Das Bild im Kopf des Lesers wird sowieso anders aussehen als Deine Vorstellung. Außerdem „verwässern“ viele Details das Bild, sodass man irgendwann vor lauter Kleinigkeiten das große Ganze nicht mehr sieht.
Eine Skizze reicht völlig aus: Was sind die charakteristischen Merkmale eines Gegenstandes oder einer Figur? Was fällt als erstes ins Auge? Welche Assoziationen erwecken sie?
Joanne K. Rowling hat die Figur Severus Snape nie in allen Einzelheiten beschrieben. – Aber wir alle kennen den charakteristischen „fettigen Vorhang“ von einer Frisur.
Und an dieser Stelle auch ein Bonustipp:
Je bizarrer und ungewöhnlicher die herausgepickten Details, desto besser.
Niemanden interessiert es, dass Leonie sich morgens die Zähne putzt. Aber wenn Ludwig im Inflationsjahr 1923 sich seine Zigarre mit einem Geldschein anzündet, dann bringt das die rasende Entwertung des Geldes wunderbar auf den Punkt.
Erich Maria Remarque: Der schwarze Obelisk, Kapitel 1.
Show, don’t tell
Wozu lang und breit etwas beschreiben, wenn man es auch zeigen kann?
Erinnere Dich an den Film Die rechte und die linke Hand des Teufels und speziell an die Einführung der Figur des Müden Joe. Als Joe in einem Gasthaus eintrifft und der Wirt Bohnen verteilt, will Joe die ganze Pfanne haben und isst sie auch tatsächlich komplett auf. Das zeigt seinen Hunger äußerst eindeutig.
Wenn Du also eine Beschreibung durch eine konkrete Handlung ersetzen kannst: Tue es! Sei generell möglichst sparsam mit Adjektiven und Adverbien – denn sie „müllen“ sonst Deine Beschreibungen mit irrelevanten Details zu. Konkrete Handlungen bringen Zustände und Gefühle in der Regel viel besser auf den Punkt als nackte Beschreibungen.
Das gilt übrigens besonders bei abstrakten Wörtern. Beschreibe Deine Figuren zum Beispiel niemals als „nett“, „sympathisch“ oder „ehrfurchterregend“. Solche Wörter sind nichtssagend. Denn jeder stellt sich etwas anderes darunter vor.
Wenn Du also konkrete Bilder erzeugen willst, dann zeige und beschreibe nicht.
Vergiss dabei aber nicht, dass auch hier weniger mehr ist. Denn so schön „Show, don’t tell“ auch ist: Wenn du komplett irrelevante Details „zeigst“, dann ist das fast genauso langweilig wie eine unnötig ausführliche Beschreibung.
Mehr zum Thema „Show, don’t tell“ gibt es in einem eigenständigen Artikel.
Originelle Stilmittel und Wortwahl
Das vielleicht Schwerste an Beschreibungen ist die Originalität. Wie machen wir unsere Beschreibungen also knackig, frisch und originell?
Unter den rhetorischen Stilmitteln gibt es die sogenannten Tropen. Eine detaillierte Erklärung findest Du in der entsprechenden Reihe. An dieser Stelle begnügen wir uns damit, dass die Tropen besonders gut beeignet sind, um mit einigen wenigen Worten äußerst reiche Bilder zu erzeugen.
Besonders wichtige Vertreter sind dabei die Metapher und der Vergleich. – Vor allem, wenn sie nicht nur einen einzigen Sachverhalt beschreiben, sondern als „System“ auftreten:
Der russische Autor Evgenij Zamjatin beschreibt in seiner Erzählung Die Höhle die Zustände im winterlichen Petersburg nach der russischen Revolution, geprägt durch Hunger, Kälte und den Kampf ums nackte Überleben. Dabei benutzt er durchgängig eine Steinzeitmetaphorik: Er spricht von Mammuts, beschreibt Wohnhäuser als Felsen mit Höhlen und benutzt tierische Terminologie wie „Weibchen“ für Menschen. Damit entsteht vor dem geistigen Auge das Bild von einer evolutionären Rückentwicklung, einer postapokalyptischen Welt, und das wiederum bringt das Gefühl dieser katastrophalen Lebensbedingungen eindringlich rüber.
Doch auch alleinstehende Stilmittel können äußerst effektiv sein. – Das heißt, solange sie zur Stimmung der jeweiligen Szene passen und – vor allem – nicht abgedroschen sind. Wir alle kennen sie ja: „schnell wie der Blitz“, „Bärenhunger“ und so weiter … Wir alle kennen sie und deswegen lesen wir ganz emotionslos über sie drüber.
Nimm Dir also ruhig etwas mehr Zeit, um ein einzigartiges Bild zu erschaffen, das neu ist und den Leser aufrüttet.
Vergiss die Metaphern und Vergleiche, die du kennst. Konzentriere Dich auf die Sache, Handlung, was auch immer Du beschreiben möchtest: Stell Dir vor, dass Du es zum ersten Mal im Leben wahrnimmst. Stell Dir vor, Du hast Dein ganzes Leben hinterm Mond verbracht und kennst es nicht. Was fällt Dir daran als erstes auf? Was empfindest Du, während Du es entdeckst? Was siehst, hörst, schmeckst, fühlst und riechst Du? Welchen Dingen ähnelt es? Welche Gedanken löst es in Dir aus?
Wenn die Antworten bizarr und vielleicht sogar widersprüchlich ausfallen, dann bist Du auf einem guten Weg. Hier zum Beispiel eine eigentlich ganz unlogische, aber dafür umso kräftigere Metapher – Es handelt sich dabei um die Beschreibung des ehemaligen Schlachtfeldes bei Verdun:
„Nirgends auf der Welt gibt es ein solches Schweigen, denn dieses Schweigen ist ein gewaltiger versteinerter Schrei.“
Erich Maria Remarque: Schweigen um Verdun.
Ein Schrei ist das Gegenteil von Schweigen – und er kann auch nicht steinern sein. Doch gerade deswegen wirkt diese Metapher: Sie ist ungewöhnlich, sie rüttet auf und sie verwischt die Grenzen zwischen der stillen Gegenwart und dem Grauen des Krieges, der sich für immer in die Seele des Betrachters eingebrannt hat.

Die Macht der Erzählperspektive
Was eine Beschreibung interessant und einzigartig machen kann, ist die individuelle Sichtweise einer Figur. Lieschen sieht die Dinge anders als Fritzchen – und was sie wahrnimmt, denkt und wie sie es wiedergibt, sagt wiederum sehr viel über sie aus.
Wenn Du also einen intern fokalisierten Erzähler hast, dann schreit das förmlich nach einer Beschreibung, wie sie nur von Deiner Reflektorfigur stammen könnte.
Damit hängt auch die Stilistik der Beschreibungen, wie poetisch und bildlich sie sein sollen, von der Erzählperspektive ab: Wenn die Reflektorfigur etwas poetischer veranlagt ist, dann brauchen Deine Texte mehr Metaphern als bei einer weniger künstlerisch veranlagten Figur.
Diese Herangehensweise ist umso effektiver, wenn Du Deine Geschichte aus einer ungewöhnlichen Perspektive erzählst.
In Lew Tolstojs Erzählung Der Leinwandmesser zum Beispiel erhalten wir einen Einblick in das Innenleben eines Pferdes. Dieses hat unter anderem seine höchst eigene Sichtweise auf das Thema Besitz.
Ein anderes Beispiel findet sich in Das wandelnde Schloss von Diana Wynne Jones: Hier gibt es ein Kapitel, in dem die Protagonistin Sophie, die in einer Fantasy-Welt aufgewachsen ist, in unsere reale Welt gelangt. Dabei sieht sie Dinge wie einen Fernseher, Videospiele und Autos zum ersten Mal und hat dementsprechend eine interessante Wahrnehmung davon.
Wichtig bei Erzählperspektiven ist aber, sie auch wirklich einzuhalten. Das heißt: Wenn Du durch Fritzchens Augen beschreibst, dann stellen Beschreibungen von Dingen, die Fritzchen nicht sehen kann, oder Fritzchens Wirkung nach außen hin einen Bruch dar. Doch zur Einhaltung der Erzählperspektive ist bereits ein eigener Artikel geplant. Deswegen gehe ich an dieser Stelle nicht ausführlicher darauf ein.
Beschreibungen in der Praxis
So viel zu den Tipps an sich. – Doch die wichtigste Frage ist immer noch offen:
Wann setzt man welche Art von Bereibungen ein?
Die allgemeinste Antwort darauf ist:
Es kommt auf die Geschichte an.
Doch was bedeutet das konkret? Hier einige grundsätzliche Überlegungen, an denen ich mich entlanghangeln würde:
- Wie bildlich Dein Text sein soll, musst Du selbst wissen. Das variiert von Text zu Text und von Zielgruppe zu Zielgruppe. Aber mein Eindruck wäre, dass handlungsorientietere Texte meist weniger Beschreibungen haben als Geschichten, in denen es mehr um das Innenleben von Figuren geht. Gerade Beschreibungen der Außenwelt spiegeln häufig das Innenleben der Reflektorfiguren. Ob Erna zum Beispiel einen sonnigen Tag als etwas Schönes oder als Hohn wahrnimmt, hängt sehr stark von ihrer eigenen Verfassung ab.
- Und das gilt nicht nur für ganze Texte, sondern auch für einzelne Szenen: Denn je länger eine Beschreibung ist, desto länger pausiert die Handlung. - Vor allem, wenn die Beschreibung losgelöst ist vom Innenleben der Reflektorfigur. Und besonders Actionszenen vertragen sowas nicht. Clevere Metaphern und kurze Vergleiche hingegen können auch handlungsfokussiertere Szenen bereichern durch witzige, dramatische oder anderweitig emotionale Bilder.
(Mehr zum Thema Pause und Erzähltempo allgemein gibt es in einem eigenen Artikel.) - Nicht zuletzt zeichnet die Häufigkeit von Metaphern und die Kunstfertigkeit von Beschreibungen generell den individuellen Stil Man muss nicht auf Teufel komm raus jemand sein wollen, der man nicht ist. Wenn originelle und poetische Metaphern Dir schwer fallen – dann sei eben sparsam mit ihnen und lass Deinen Text auf einem anderen Gebiet glänzen. Nichts liest sich hölzerner als zwanghaft aus den Fingern gesaugte Beschreibungen eines Möchtegern-Poeten.
- Gleichzeitig gilt aber auch: Übung macht den Meister! Nur, weil Du gerade jetzt vielleicht keine guten Beschreibungen scheibst, heißt das nicht, dass das so bleiben muss. Lies Bücher mit guten Beschreibungen – ich persönlich empfehle meinen Lieblingsautor Remarque – und dann übe, übe, übe!