Wenn wir eine Geschichte lesen, wollen wir dabei etwas empfinden. Wir wollen mit den Figuren mitfiebern, wir wollen ihre Freude und ihren Schmerz teilen und ihre Beziehungen untereinander spüren, eine emotionale Achterbahn. Wie beschreibt man also Emotionen und Gefühle und wie weckt man sie beim Leser? In diesem Artikel reden wir über einige Techniken …
Die Folien für dieses Video gibt es für Steady-Abonnenten und Kanalmitglieder auf YouTube als PDF zum Download.
Gefühle sind vielleicht das Wichtigste an einer Geschichte. Denn wir wollen Beziehungen zu den fiktiven Figuren knüpfen, in fremde Leben eintauchen und mitfiebern.
Wie geben wir also die Gefühle der Figuren so wieder, dass der Leser sie nachempfinden kann?
Schauen wir uns das an!
Erzählperspektive und Introspektion
Bevor man irgendetwas beschreiben kann, muss man erst mal wissen, durch wessen Prisma und aus welcher Perspektive das Etwas wahrgenommen wird. Ein Erwachsener nimmt anders wahr als ein Kind, ein Unfallopfer anders als ein Zeuge, ein Anwalt anders als ein Automechaniker, ein Stadtbewohner anders als jemand vom Land und ein Mann anders als eine Frau. – Und das gilt eben auch für das Beschreiben von Gefühlen.
Der vielleicht beste Ratschlag zu diesem Thema, über den ich je gestolpert bin, stammt von Ellen Brock:
Es gibt zwar den häufigen Schreibtipp „Show, don’t tell!“, aber sie empfiehlt, sich weder auf „Show“ noch auf „Tell“ wirklich systematisch zu verlassen. Denn man kann bei beidem übertreiben – zum Beispiel, wenn man „showen“ will und immer wieder dieselben Gesten beschreibt oder beim „Tellen“ immer wieder dieselben Emotionen benennt, sei es auch mit variierender Formulierung.
Ellen ist vielmehr der Meinung, dass die meisten Autoren nicht das Beschreiben von Gefühlen verbessern müssen, sondern Introspektion: die Denkweise der Figuren, ihre subjektive Weltwahrnehmung, ihre Interpretation der eigenen Gefühle …
Es geht also nicht darum, welche Emotionen und Gefühle eine Figur hat, sondern um ihre subjektive Version davon.
Stellen wir uns zum Beispiel vor, wie verschiedene Figuren darauf reagieren, während einer Straßenschlacht zwischen zwei Banden angeschossen zu werden:
- Für ein erfahrenes, mit Narben übersätes Bandenmitglied, im früheren Leben Berufssoldat, ist die Verwundung zwar schmerzhaft, aber nichts Neues. Bestimmt kann er realistisch einschätzen, wie ernst die Wunde ist, und sich unter Umständen sogar selbst Erste Hilfe leisten.
- Ein unerfahrenes Bandenmitglied, ein Teenager, der Straßenschlachten bisher nur aus Filmen kannte, ist überwältigt von dem Schmerz, der viel heftiger ist, als er je geglaubt hätte, und er hat Panik und schreit sich die Seele aus dem Leib.
- Ein Arzt, der unglücklicherweise gerade im Moment des Ausbruchs der Schlacht vorbeilief und nur zufällig erwischt wurde, hat einerseits Angst und höllische Schmerzen, andererseits beobachtet er auch seinen Zustand und weiß ziemlich genau, was in seinem Körper gerade vor sich geht und was er tun muss, wenn er überleben will. Wenn seine Wunde nicht zu schlimm ist, versucht er vielleicht sogar, anderen Verletzten zu helfen. Außerdem denkt er an seine Familie und bedauert, dass seine Verspätung zum Abendessen und seine Verwundung ihr große Sorgen bereiten werden.
- Und so weiter geht es mit jeder anderen erdenklichen Figur …
Merkst Du also, was da passiert? Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, wie man beschreibt, aber wir haben bereits beim Was eine direkte Beziehung zur Figur selbst, wir bekommen ein Fenster in ihre Welt und können deswegen mit ihr mitfühlen. Und dann müssen wir „nur noch“ das rein Handwerkliche hinbekommen.
Mit anderen Worten:
Lass Deine Figuren reden! Sie wissen am besten, wie ihre subjektiven Emotionen und Gefühle ausgedrückt gehören.
Figuralisierte Erzählerrede
Dazu steht Dir ein breites Arsenal an Techniken zur Verfügung, nämlich:
- die direkte Rede,
- die indirekte Rede,
- die erlebte Rede,
- der innere Monolog und
- der Bewusstseinsstrom.
Über sie alle haben wir jedoch bereits in einem früheren Artikel gesprochen; daher werde ich das Thema an dieser Stelle nicht weiter vertiefen. Außer dass ich betonen möchte,
dass je figuralisierter die Erzählerrede ist, also je stärker der Erzähler die Perspektive der Figur übernimmt und somit selbst in den Hintergrund rückt, desto mehr Nähe entsteht zwischen Leser und Figur und desto stärker werden dementsprechend Emotionen übertragen.
Pass dabei aber auf, dass Du die gewählte Perspektive einhältst. Doch weil ich auch dazu schon einen Artikel geschrieben habe, werde ich es bei diesem Thema ebenfalls bei einer Erwähnung belassen.
Herausforderungen bei der Introspektion
Nun hat man aber, wenn man sich auf das Innenleben einer Figur fokussiert, manchmal trotzdem ein Problem:
Zum Beispiel dürfte jeder, der schon mal versucht hat, aus der Perspektive eines Kindes zu schreiben, festgestellt haben, dass es verdammt schwierig ist. Die Wahrnehmung und die Art, Gefühle zu verarbeiten und zu äußern, sind in dem Alter ist nun mal ganz anders als bei Erwachsenen. Und je jünger das Kind, desto schwieriger ist die Perspektive. Wir sind alle zwar irgendwann mal Kind gewesen, aber mit den Jahren haben wir vergessen, wie das war.
Natürlich können wir hier rückblickend aus der erwachsenen Perspektive schreiben, aber dann entsteht ja wieder Distanz zur erlebenden und fühlenden kindlichen Figur. Die erwachsene Perspektive kann an sich natürlich auch emotional und ergreifend sein, aber es ist eben kein Fenster in die Innenwelt des Kindes. Obwohl wir alle also selbst mal Kinder waren, haben wir hier dieselben Probleme, wie wenn wir über etwas zu schreiben versuchen, womit wir keine eigene Erfahrung haben. Und das wiederum ist ein Thema, das bereits für die erste Hälfte 2022 geplant ist. Deswegen bitte ich an dieser Stelle um ein paar Monate Geduld.
Ein anderes Problem wäre, wenn die Figur, deren Innenleben beleuchtet wird, sich etwas einredet oder ihre eigenen Gefühle nicht richtig wahrnimmt. Mit anderen Worten: Figuren, auf deren Introspektion man sich nicht verlassen kann. Bei solchen Reflektoren kann es leicht passieren, dass nur die Irrtümer der Figur beim Leser ankommen, nicht ihr wahrer Zustand. Hier muss man also wohl oder übel ausschließlich mit Beschreibungen und „Show, don’t tell“ die wahren Gefühle andeuten, Testleser drüberjagen und notfalls am Ende eine eindeutige Auflösung liefern. In einem anderen Artikel gehen wir aber gesondert auf das unzuverlässige Erzählen ein; deswegen will ich auch dieses Thema hier nicht weiter ausführen.
Beschreibungen
Nun haben wir aber genug über das Was gesprochen und können uns dem versprochenen Handwerklichen zuwenden. Und wenn wir über das Beschreiben von Emotionen und Gefühlen reden, dann ist die erste handwerkliche Technik eben das buchstäbliche Beschreiben.
Über das Beschreiben generell haben wir bereits in einem früheren Artikel gesprochen. – Und alle Tipps dort sind natürlich auch auf Emotionen und Gefühle anwendbar. Nur, dass hier die Perspektive nochmal wichtiger ist: Denn im Grunde kann jeder ein gelbes Auto beschreiben. – Klar, verschiedene Menschen haben da verschiedene Schwerpunkte, aber Emotionen und Gefühle sind generell persönlicher und deswegen stehen die Persönlichkeit der Figur und die Situation, in der sie sich gerade befindet, noch mehr im Vordergrund.
So wird der Bewusstseinsstrom eines Soldaten, der ohne Deckung in eine schwere Beschießung geraten ist, sehr emotional sein. Anders sieht es aus, wenn dieser Soldat nach dem Krieg ein Buch über seine Kriegserlebnisse schreibt, in dem er seine damalige Perspektive für Zivilisten, quasi für „Extradoofe“, erläutert und dabei – vielleicht aufgrund einer PTBS – bemerkenswert sachlich und gefühlskalt ist:
„Ich glaube einen Vergleich gefunden zu haben, der das besondere Gefühl dieser Lage, in der ich wie jeder andere Soldat dieses Krieges so oft gewesen bin, recht gut trifft: Man stelle sich vor, ganz fest an einen Pfahl gebunden und dabei von einem Kerl, der einen schweren Hammer schwingt, ständig bedroht zu sein. Bald ist der Hammer zum Schwung zurückgezogen, bald saust er vor, daß er fast den Schädel berührt, dann wieder trifft er den Pfahl, daß die Splitter fliegen – genau dieser Lage entspricht das, was man deckungslos inmitten einer schweren Beschießung erlebt.“
Ernst Jünger: In Stahlgewittern, Kapitel: Der Auftakt zur Somme-Schlacht.
Was das Beschreiben an sich angeht, so greift der Autor hier auf einen Vergleich zurück und benutzt dabei eine Anapher („Bald … bald …“), um den Wechsel zwischen dem Warten und den Schlägen auch durch die Sprache zu veranschaulichen.
Anders sieht die Beschreibung aus, wenn ein frisch verliebtes fünfzehnjähriges Mädchen seine Gefühle in einem Tagebuch niederschreibt:
„Wenn ich morgens aufwache und an ihn denke und mit geschlossenen Augen daliege, damit Julie glaubt, dass ich noch schlafe, liegt mein Herz wie ein schwerer Klumpen in meiner Brust. Vor lauter Liebhaben. Ich habe nicht gewusst, dass man Liebe wirklich spüren kann – ich meine, körperlich. Bei mir ist es wie eine Art von Ziehen in der Herzgegend.“
Annemarie Selinko: Désirée, Kapitel: Marseille, Anfang Prairial. (Der Wonnemonat Mai geht zu Ende, sagt Mama).
Diese Beschreibung ist mehr auf das Mitfiebern ausgerichtet: Wir bekommen sie durch die fünfzehnjährige Désirée Clary selbst – und zwar mit allem, was dazugehört. Sie beschreibt ihre Empfindungen im Detail, fast mit einer Art kindlich-wissenschaftlichem Interesse, weil es für sie ein völlig neues Erlebnis ist. Auch sie operiert mit Vergleichen, aber ihr Satzbau ist abgehackter, emotionaler.
„Show, don’t tell!“
Nun sind Beschreibungen im buchstäblichen Sinne hin und wieder angebracht – doch wenn etwas beschrieben wird, pausiert die Geschichte, und das kann ihr die Spannung nehmen. Deswegen versuchen wir meistens zu Recht, die Emotionen und Gefühle direkt im Geschehen selbst unterzubringen.
Und das geht mit „Show“ und „Tell“. Grundsätzlich haben wir aber schon in einem früheren Artikel darüber gesprochen, und daher steigen wir hier ohne weiteres Vorgeplänkel direkt in die Emotionen ein …
„Tell“, „Show“ und Introspektion
Ich klaue und verunstalte mal ein Beispiel aus der KreativCrew:
Als Fritzchen die Nachricht hörte, begann Zorn in ihm zu brodeln wie in einem Vulkan.
Hier haben wir zwar einen bildlichen, wenn auch etwas kitschigen Vergleich mit einem Vulkan und das Brodeln des Zorns ist eine Metapher, aber wir bekommen immer noch gesagt, dass Fritzchen zornig ist. Es ist also klassisches „Tell“, gekoppelt an eine Beschreibung.
Nächste Variante, ebenfalls geklaut und verunstaltet:
Als Fritzchen die Nachricht hörte, schmetterte er in seinem Zorn den Becher gegen die Wand.
Hier entfällt die Beschreibung des Zorns, aber die Emotion an sich wird dennoch benannt. Wir bekommen also immer noch gesagt, was Fritzchen fühlt. Doch gleichzeitig haben wir auch eine neue Komponente: Fritzchens Zorn wird durch eine konkrete Handlung untermalt, die seine Emotion zeigt. Hier haben wir also eine Mischung aus „Tell“ und „Show“.
Betrachten wir schließlich noch eine Version:
Das konnte doch nicht wahr sein! Er packte seinen Becher und schmetterte ihn gegen die Wand.
Hier dürfte unmissverständlich klar sein, dass Fritzchen einen Wutanfall hat. Die Emotion wird jedoch nicht benannt, sondern nur durch Fritzchens Gedanken und Handlungen gezeigt. Es ist somit ein Zusammenspiel aus Introspektion und „Show“.
Emotionen und Außenwahrnehmung
Nun ist diese letzte Kombination ja schön und gut, aber was, wenn wir gar nicht aus Fritzchens Perspektive schreiben? Wie bringen wir seine Emotionen trotzdem rüber?
Die Sache ist: Irgendwessen Perspektive haben wir trotzdem. Wenn also Lieschen die Reflektorfigur ist, können wir zwar nicht in Fritzchens Kopf schauen, aber wir können seine äußerlichen Reaktionen durch Lieschens Prisma wahrnehmen.
Das könnte zum Beispiel so aussehen:
Es tat körperlich weh, diese Worte herauszupressen, doch Lieschen schuldete Fritzchen die Wahrheit.
„Die Mission ist gescheitert.“
Fritzchen erstarrte. Glotzte, während die Erkenntnis langsam einsetzte. Und dann, ohne jede Vorwarnung, packte er seinen Becher und schmetterte ihn gegen die Wand.
Hier geht es vorrangig um Lieschens Gefühle und Wahrnehmungen: Sie will Fritzchen die schlechte Nachricht nicht überbringen, aber sie tut es dennoch aus Pflichtgefühl heraus. Und dann beobachtet sie seine Reaktion. Sie kann seine Gedanken natürlich nicht lesen, aber sie kann es ihm ansehen, wie die Zahnräder in seinem Kopf die Nachricht verarbeiten und wie er dann seiner Wut Ausdruck verleiht. Die Emotion kommt an dieser Stelle dadurch zustande, dass Lieschen offenbar eine positive Beziehung zu Fritzchen hat. Wir müssen davon ausgehen, dass Fritzchens Reaktion für sie schmerzhaft ist, und wenn ihre Beziehung vorher angemessen rübergebracht wurde und wir mit Lieschen mitfühlen, als sie die schlechte Nachricht überbringt, dann muss ihr Schmerz bei Fritzchens Reaktion nicht extra erwähnt werden: Wir stecken ja bereits in ihrem Kopf, wir teilen ihre Beziehung zu Fritzchen und ihre Beobachtungen, und unser Gehirn löst in uns von selbst Gefühle von Schmerz und Bedauern aus.
Weil Introspektion hier bei Fritzchen aber komplett wegfällt und „Tell“ uns aus Lieschens Perspektive herausreißen würde, wird hier „Show“ besonders wichtig. Denn wir erkennen die Emotionen anderer Menschen hauptsächlich an Körpersprache, Redeweise und am Verhalten generell – und so funktioniert es auch bei Figuren, in deren Köpfe wir keinen Einblick haben.
Bloß lauern hier zwei Gefahren, nämlich Klischees und Realismus:
- Mit Klischees meine ich, dass der Autor für eine Emotion nur eine oder nur einige wenige körpersprachliche Reaktionen hat, die häufig auch in anderen Werken verwendet werden. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn in einem Werk sehr viel geseufzt wird, weil dem Autor keine anderen Möglichkeiten für den Ausdruck unangenehmer Gefühle einfallen und der gefühlte Rest der Welt ja auch überwiegend mit dem Seufzen operiert. Um mehr Vielfalt in die Sache zu bringen, empfehle ich intensives Beobachten von Menschen, gerne auch in Kombination mit einem Glossar für Körpersprache. Bedenke dabei aber, dass Menschen unterschiedlich sind und auch ihre Körpersprache individuelle Eigenheiten hat. Statt also körpersprachliche Äußerungen wie aus einem Wörterbuch einfach in den Text zu packen, solltest Du überlegen, wie sich die Körpersprache der einzelnen Figuren unterscheidet: wer wild mit dem Armen fuchtelt, wer still in der Ecke sitzt und wer Becher gegen die Wand schmeißt. Idealerweise sollte jede Figur ihre eigene Körpersprache haben.
- Mit Realismus meine ich, dass echte Menschen ihre Gefühle oft verbergen. Und jemand, der seine Mitmenschen nicht durch seine unangenehmen Gefühle in Verlegenheit bringen oder nervige Fragen vermeiden möchte, wird sein Seufzen herunterschlucken und vielleicht sogar breit grinsen. Aber je nachdem, wie gut seine schauspielerischen Fähigkeiten sind und wie gut die anderen Figuren ihn kennen, wird jemand anderem vielleicht auffallen, dass dieses Grinsen etwas verkrampft wirkt. Bedenke also, dass die Äußerung von Emotionen auch verschachtelt sein bzw. mehrere Schichten haben kann. Und das hängt wiederum mit der Persönlichkeit der Figur und der jeweiligen Situation Mit anderen Worten: Hier zeigt sich mal wieder, wie wichtig es ist, Menschen zu beobachten und seine fiktiven Figuren genau zu kennen.
Rhetorische Stilmittel
Wie Du also merkst, gibt es verschiedene Kombinationen von Techniken, um Emotionen rüberzubringen, und sie alle haben einen unterschiedlichen Effekt, auch je nach Situation, Wortwahl etc. Es ist also schwierig, irgendwelche Regeln zu formulieren. Zwar ist an „Show, don’t tell“ sehr viel dran, aber ich bezweifle, dass irgendjemand einen ganzen Text lesen möchte, in dem Emotionen niemals benannt werden. „Tell“ macht sehr viel Sinn, wenn man sich mit der entsprechenden Emotion nicht lange aufhalten möchte – „Show“ hingegen ist bei wichtigen Emotionen angebracht, die sich als Bilder im Gedächtnis des Lesers einbrennen sollen. Und wenn man die Emotionen auf den Leser übertragen will, nutzt man Introspektion.
Und rhetorische Stilmittel sind auch nie verkehrt. Denn die sehr konkrete Form, die man dem Ausdruck oder der Beschreibung der Emotion gibt, kann ebenfalls indirekt Gefühle transportieren. Hier zum Beispiel das unerwartete Wiedersehen von zwei Liebenden, die durch sehr widrige Umstände eine Weile getrennt waren:
„Ich vergaß das Fenster zuzumachen, ich vergaß, in meine Hausschuhe zu schlüpfen, ich vergaß, irgendetwas umzunehmen, ich vergaß, dass ich nur ein Nachthemd trug, ich vergaß, was sich gehört und was sich nicht gehört – ich rannte wie eine Besessene die Stiegen hinunter, öffnete die Haustür, spürte Kieselsteine unter meinen bloßen Füßen, und dann spürte ich seinen Mund auf meiner Nase. Es war ja so dunkel, und im Dunkeln kann man sich nicht aussuchen, wohin man küsst.“
Annemarie Selinko: Désirée, Kapitel: Marseille, Ende Fructidor. (Mitte September).
Die Wiederholung von „ich vergaß“ macht deutlich, lässt den Leser spüren, dass die junge Désirée in diesem Moment wirklich von ihren Emotionen überwältigt ist und an nichts anderes denken kann als an ihren Geliebten. Darauf folgt eine klimaktische Aufzählung von Handlungen, von denen jede Désirée ihrem Geliebten näher bringt, und das Ganze gipfelt in einem Kuss. Und damit es nicht kitschig wird, ist es ein versehentlicher, aber in dieser Situation äußerst realistischer blinder Kuss auf die Nase. Daraufhin entspannt sich die Lage, die Stilmittel lassen nach und es folgt eine eher ruhige Erklärung für das putzige Missgeschick.
Weil ich aber bereits eine ganze Reihe zu rhetorischen Stilmitteln habe, mache ich auch an dieser Stelle einen Schnitt und wir gehen über zu meinen abschließenden Tipps fürs Beschreiben von Emotionen …
Sonstige Tipps
Zwar würde ich Dir dringend ans Herz legen, die oben erwähnten Artikel zu lesen, aber einige Punkte möchte ich hier dennoch explizit ansprechen:
- Da hätten wir an erster Stelle natürlich Realismus und Fingerspitzengefühl bei sensiblen Themen und/oder bei Dingen, bei denen man keine persönlichen Erfahrungen hat. Hier ist sehr viel Recherche angesagt, und unter diesem Link findest Du meinen Artikel über sensiblen Umgang mit Gewalt; über das Schreiben ohne persönliche Erfahrung sprechen wir ja noch 2022. Ich bitte Dich also vorerst um Geduld, möchte die Wichtigkeit realistischer Gefühle aber auf jeden Fall erwähnt haben. Denn fiktionale Werke prägen unsere Wahrnehmung der Realität und die Folgen schlechter Darstellung können tragisch sein.
- Auch solltest Du darauf achten, dass es bei den Gefühlen in Deinem Werk ein Auf und Ab gibt. Denn niemand will ein Buch lesen, das durchweg fröhlich oder durchweg deprimierend ist. Dazu aber mehr im Artikel über das Aufbauen einer interessanten Handlung nach dem Bestseller-Code von Archer und Jockers.
- Vergiss auch nie, bei der Introspektion, dem Beschreiben und beim „Show“ möglichst viele Sinne einzubeziehen. Durch das Medium Film sind wir oft stark auf das Visuelle und Auditive fokussiert, dabei können wir jedoch auch noch riechen, schmecken und tasten. Wenn wir diese Sinne vernachlässigen, geht unseren Beschreibungen also eine Menge Potential verloren.
- Und nicht zuletzt ist natürlich auf das zur jeweiligen Textstelle passende Pacing zu achten. Bei Action muss alles schnell gehen und die Gefühle sollten idealerweise handlungsbegleitend eingebunden werden. Ausschweifende Beschreibungen von Gefühlen hingegen sind eher dann angebracht, wenn das konkrete Gefühl eine besondere Rolle spielt, also zum Beispiel das Verliebtsein in einem Liebesroman. Nichtdestotrotz würde ich persönlich jedoch sagen, dass die besten Gefühlsbeschreibungen mit wenigen Worten auf den Punkt kommen.
Schlusswort
So viel zum Beschreiben von Emotionen und Gefühlen. Ich hoffe, es ist rübergekommen, dass es keine für sich abgetrennte Disziplin ist, sondern hier das Herausarbeiten von Figuren, die Erzählperspektive, sprachliches Handwerk und viele andere Bereiche ineinander greifen. Außerdem gibt es keine Schleichwege und Du kommst nicht drum herum zu üben, zu scheitern und es das nächste Mal besser zu machen. Es ist etwas, das Zeit und Erfahrung braucht.
Was ebenfalls helfen kann, ist das Analysieren von emotionalen Szenen in Büchern. Deswegen zerlegen wir am 21.11.2021 ein paar solcher Szenen in einem Steady-Livestream …


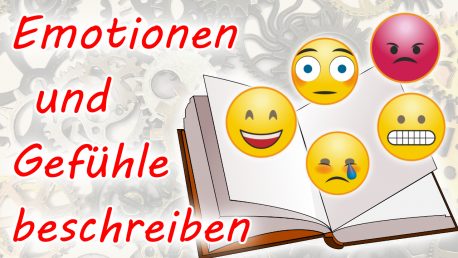
„Super Text. Vielen Dank! Gerade das viele Seufzen ist auch eines meiner Probleme“, sagte AZR und seufzte. 🙂
Noch eine Frage:
Werden bei den Beispielen
„Als Fritzchen die Nachricht hörte, begann Zorn in ihm zu brodeln wie in einem Vulkan.“
und
„Als Fritzchen die Nachricht hörte, schmetterte er in seinem Zorn den Becher gegen die Wand.“
nicht eigentlich show und tell gemischt. Denn zwar wird die Emotion selbst nur mitgeteilt, die Intensität wird aber beschrieben. Die Emotion selbst ergibt sich bei show ja gewöhnlich aus dem Kontext, so unmissverständlich finde ich den Becherwurf daher gar nicht.
-
Es klopfte. Lieschen betrat das Zimmer.
„Wir…“, begann sie, „Wir haben es geschafft!“
Das konnte doch nicht wahr sein! Er packte seinen Becher und schmetterte ihn gegen die Wand.
-
bzw.
-
Lieschen wusste nicht, wie sie es ihm sagen sollte. Sie konnte es ja selbst kaum glauben.
„Wir haben es geschafft!“
Fritzchen erstarrte. Glotzte, während die Erkenntnis langsam einsetzte. Und dann, ohne jede Vorwarnung, packte er seinen Becher und schmetterte ihn gegen die Wand.
-
Würde man hier nicht eher (unbändige) Freude deuten? So wie wenn man sonst schreibt:
Fritzchen warf vor Freude seinen Becher gegen die Wand.
Das Seufzen ist auch bei mir eine der großen Baustellen. *seufz* 😅
Zu Deiner Frage: Ich glaube, Du verwechselst ein wenig Bildlichkeit und Show. Das Brodeln des Zorns wie in einem Vulkan kann man sich zwar sehr gut als Bild vorstellen, aber der Vergleich wird vom Erzähler nur so hingestellt und ist außerdem auch sehr abstrakt: Denn wie sieht es denn konkret aus, wenn der Zorn brodelt wie in einem Vulkan? Im Kopfkino erscheint eher der Vulkan als eine konkrete Zornesäußerung wie beispielsweise das Becherschmeißen. Aber Du hast natürlich recht, Show hat sehr viel mit Kontext zu tun. Eben weil der Erzähler hier Bilder liefert, die der Leser selbstständig deuten muss.
Das ist ein gutes Argument. Eine Metapher macht noch keine Beschreibung. Ich weiß eigentlich nicht einmal, ob ein Vulkan wirklich brodelt und wie genau man sich das vorzustellen hat.
Allerdings ist es beim zweiten Beispiel dann doch schon so, dass die Emotion benannt und durch die Beschreibung gewissermaßen konkretisiert wird, oder?
Na ja, eine Metapher dient schon der Beschreibung. Bloß ist sie nicht automatisch Show.
Benannt wird die Emotion in beiden Beispielen, also beides Tell. Der Unterschied ist nur in der Art der Konkretisierung, um mal Dein Wort aufzugreifen. Beim ersten Beispiel wird durch eine Beschreibung (Vulkan, brodeln) „gewissermaßen konkretisiert“, beim zweiten durch eine konkrete Handlung, also Show.
Naja ich hab jetzt pauschal „show“ und „tell“ durch „beschreiben“ und „mitteilen“ ersetzt. Ich meinte also: Eine Metapher alleine mach noch kein „show“
Danach würde ich sagen, wir sind uns im Ergebnis einig. 🙂
Ja, dann sind wir uns einig. Ich stand da nur auf dem Schlauch, weil ich „beschreiben“ ja in anderer Bedeutung verwendet habe.