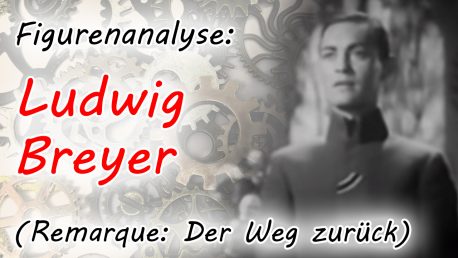„Im Westen nichts Neues“: Was macht eine gute Verfilmung aus? (1930, 1979, 2022)
2022 erschien endlich eine deutsche Verfilmung von Remarques Antikriegsklassiker „Im Westen nichts Neues“. Doch kann sie mit den beiden älteren Verfilmungen von 1930 und 1979 mithalten? In diesem Video vergleichen wir alle drei Verfilmungen und beantworten die Frage: Was macht eigentlich eine gute Verfilmung aus?