Jede Geschichte besteht aus Erzählerrede und in der Regel auch Figurenrede. Und während die Erzählerrede – bzw. der Erzählerbericht – einfach die Rede des Erzählers ist (Handlungswiedergabe, Beschreibungen, Kommentare etc.), kommt die Figurenrede in vielen verschiedenen Formen vor: direkte Rede, indirekte Rede, erlebte Rede, innerer Monolog, Bewusstseinsstrom. Natürlich stellen die meisten davon eine Figuralisierung der Erzählerrede dar – und genau hierin liegt ihre Bedeutung: Der Grad der Figuralisierung beeinflusst maßgeblich die Nähe des Lesers zu den Figuren …
Die Folien für dieses Video gibt es für Steady-Abonnenten und Kanalmitglieder auf YouTube als PDF zum Download.
In jeder Geschichte gibt es Figuren. Und meistens reden sie: miteinander oder mit sich selbst.
Doch auch das Erzählen an sich ist eigentlich Rede: die Rede des Erzählers.
Somit besteht ein Erzähltext aus Erzählerrede und Figurenrede. Und während Erstere einfach die Rede des Erzählers darstellt, findet man Letztere in verschiedenen Formen:
- in der direkten Rede,
- in der indirekten Rede,
- in der erlebten Rede,
- im inneren Monolog und
- im Bewusstseinsstrom.
In diesem Artikel schauen wir uns also die Redewiedergabe in Geschichten an und wie die einzelnen Formen sich voneinander unterscheiden.
Erzählerrede und Figurenrede
Auf den ersten Blick sind Erzählerrede und Figurenrede leicht voneinander zu unterscheiden:
„Inzwischen war Porthos herangekommen und begrüßte Athos. Als er sich d’Artagnan zuwandte, machte er ein ganz verdutztes Gesicht. Er hatte, nebenbei bemerkte, [sic!] sein Wehrgehänge gewechselt und den Mantel zu Hause gelassen.
»Ja, was heißt denn das?« rief er.
»Das ist der Herr, mit dem ich mich schlage«, erklärte Athos und wies auf d’Artagnan.
»Ich schlage mich auch mit ihm«, sagte Porthos.
»Aber erst in einer Stunde«, bemerkte d’Artagnan.
»Und ich«, rief Aramis, der in diesem Augenblick herankam, »schlage mich ebenfalls mit ihm.«
»Aber erst um zwei«, sagte d’Artagnan gelassen.“
Alexandre Dumas: Die drei Musketiere, V. Kapitel: Die Musketiere des Königs und die Leibgarde des Kardinals.
In der Erzählerrede wird berichtet, was in der Geschichte passiert und wer was tut; der Erzähler beschreibt und erklärt, reflektiert, wertet und kommentiert und wendet sich in manchen Geschichten sogar direkt an den Leser.
Jedoch wird die Erzählerrede – oder der Erzählerbericht (wie sie oft auch genannt wird) – oft von der Figurenrede unterbrochen. Dabei ist diese im obigen Beispiel klar gekennzeichnet:
- Es wird wörtlich zitiert, was die Figuren „tatsächlich“ gesagt haben.
- Diese Zitate sind durch entsprechende Satzzeichen gekennzeichnet.
- Die Erzählerrede wird unterbrochen und
- die 3. Person (er) wechselt in die 1. Person (ich).
- In den Begleitsätzen steht klar und deutlich, dass hier eine Figur spricht.
Und weil diese Figurenrede eben so wörtlich und direkt ist, nennt man sie wörtliche oder direkte Rede.
Direkte Rede: Zeichensetzung
An dieser Stelle ein kleiner Exkurs zur Zeichensetzung bei der direkten Rede, weil das oft falsch gemacht wird:
- Wörtliche Rede wird immer zwischen Anführungsstriche gesetzt: Standardmäßig stehen die Anführungsstriche am Anfang unten und am Ende oben.
Fritzchen sagte: „Mir ist kalt.“
- Die wörtliche Rede wird vom Begleitsatz durch ein Komma abgetrennt. Dieses steht außerhalb der Anführungsstriche.
„Mir ist kalt“, sagte Fritzchen.
- Wenn auf den Satz der wörtlichen Rede der Begleitsatz folgt, wird bei Aussagesätzen kein Punkt gesetzt. Frage- und Ausrufezeichen aber schon. Das Komma, das den Begleitsatz von der wörtlichen Rede abtrennt, bleibt!
„Ist dir kalt?“, fragte Lieschen.
„Ja, mir ist kalt!“, rief Fritzchen.
Ja, manchmal sieht man das auch in veröffentlichten Büchern anders gehandhabt – auch im obigen Beispiel. Das bedeutet aber nicht, dass man ohne guten Grund gegen die Regeln der deutschen Zeichensetzung verstoßen sollte.
Wenn Erzählerrede und Figurenrede verschmelzen
So säuberlich getrennt die Erzähler- und Figurenrede im obigen Beispiel auch waren: So eindeutig ist es nicht immer!
Denn erstens ist anzumerken, dass die Erzählung ja immer durch einen Erzähler wiedergegeben wird und wir keine Garantie haben, dass die wörtliche Rede tatsächlich so gesagt wurde. Wir gehen in der Regel davon aus, dass sie authentisch ist – und meistens ist sie auch so gedacht -, aber rein theoretisch obliegt es immer noch allein dem Erzähler, das Gesagte wörtlich wiederzugeben oder stilistisch oder sogar inhaltlich abzuwandeln. Stichpunkt unzuverlässiges Erzählen.
Zweitens – und darüber sprechen wir heute ausführlicher – sieht man die Erzählerrede oft nicht in ihrer Reinform, sondern mit Merkmalen der Figurenrede. Und der erste Schritt zur Figuralisierung der Erzählerrede ist die indirekte Rede …
Indirekte Rede
Die indirekte Rede kommt ohne Anführungsstriche aus, ist aber immer noch klar identifizierbar:
Fritzchen sagte, ihm sei kalt.
Fritzchen sagte, dass ihm kalt sei.
Signale, anhand derer wir erkennen, dass hier eine Figur spricht, sind Folgende:
- Es steht klipp und klar, dass hier Fritzchen spricht.
- Das Gesagte ist durch ein Komma – und im zweiten Beispiel auch durch ein „dass“ – abgetrennt und
- steht im Konjunktiv.
Die indirekte Rede wirkt weniger authentisch als die direkte, weil sie kein Zitat ist. Es ist eindeutig der Erzähler, der das Gesagte wiedergibt, nicht die Figur selbst.
Und oft fasst der Erzähler das Gesagte auch noch zusammen. Bei unserem Beispiel könnte Fritzchen zum Beispiel ursprünglich gesagt haben: „Brrr, ist das kalt hier! Meine Hände sind Eiszapfen!“ Damit hätte der Erzähler sich bei der indirekten Rede nur auf das Wesentliche fokussiert.
Der Einfluss der Erzählers auf die Wiedergabe des Gesagten ist hier also klar erkennbar. Doch während das Gesagte in der indirekten Rede weniger authentisch wirkt, ist die indirekte Rede gerade für das Erzählen authentischer als die wörtliche Rede.
Niemand erzählt seinen Freunden:
Meine Eltern haben gesagt: „Du darfst erst zur Party, wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast!“
Normalerweise sagt man eher sowas:
Meine Eltern haben gesagt, ich kann erst zur Party, wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe.
Erlebte Rede
Etwas stärker ist die Vermischung bei der erlebten Rede. Hier spricht der Erzähler sozusagen durch das Prisma der Figur, ohne es ausdrücklich zu kennzeichnen. Man könnte sagen: Die Figurenrede tarnt sich hier als Erzählerrede.
Fritzchen schauderte. Ihm war so schrecklich kalt! Seine Hände waren Eiszapfen. Hoffentlich erfror er nicht.
Formal spricht hier zwar der Erzähler, aber der Text ist durch Fritzchens Innensicht geprägt: Wir haben Einblick in seine Gefühle und Gedanken, seine Empfindungen und Hoffnungen. Dadurch ist der Leser emotional näher an der Figur und kann mitfühlen.
Ändert man die 3. Person in die 1. um und das Präteritum ins Präsens, wird es schon ein innerer Monolog …
Innerer Monolog
Beim inneren Monolog nimmt die Figur gegenüber dem Erzähler noch mehr Raum ein. Mehr noch, der Erzähler gibt die „Bühne“ fast komplett frei für das Innenleben der Figur:
Mir ist so schrecklich kalt! Meine Hände sind Eiszapfen. Hoffentlich erfriere ich nicht.
Mal angesehen davon, dass wir hier unnatürlicherweise die Gedanken eines anderen Menschen lesen und Gedanken und Gefühle generell nur selten in vollständigen, grammatikalisch korrekten Sätzen ausformuliert sind, fühlt sich die Wiedergabe der Gefühle einer Figur durch den innen Monolog ziemlich authentisch an. Es wirkt ein bisschen wie die wörtliche Rede: buchstäblich und unverfälscht. Der Erzähler bleibt schön im Hintergrund, wo er nicht vom Inneren der Figur ablenken kann.
Bewusstseinsstrom
Maximale Authentizität erreicht man eigentlich nur, wenn man einen (vermeintlich) unverfälschten Bewusstseinsstrom wiedergibt: Gedanken, Gefühle, Wort- und Satzfetzen, Erinnerungen … Alles Mögliche, was der Figur durch den Kopf geht – so chaotisch, wie es eben im Kopf der Figur auftaucht.
Kalt. Verdammt … Hände – Scheiße, wie Eiszapfen! Schon Viertel nach drei. Wo steckt sie?! Durchhalten … Durchhalten!
Kein Sonderfall: Ich-Erzähler
Nun sind wir bei den vorangegangenen Beispielen davon ausgegangen, dass der Erzähler in der 3. Person (er/sie) erzählt. Die Figuren selbst sprechen natürlich in der 1. Person.
Was ist aber, wenn wir einen Ich-Erzähler haben?
Nun, ich erinnere an die Unterscheidung zwischen dem erzählenden und dem erzählten Ich. Die Erzählerrede ist die Rede des erzählenden Ich. Die Rede des erzählten Ich ist die Figurenrede. Bei den Merkmalen von Erzählerrede und Figurenrede bleibt also alles gleich – abgesehen davon, dass in der Erzählerrede eben nicht die 3., sondern die 1. Person gebraucht wird.
Ich sagte: „Mir ist kalt.“
Ich sagte, mir sei kalt.
Und so weiter …
Der Sinn von Erzählerrede und Figurenrede
Aber wozu nun das Ganze? Denn zumindest bei der Erzählerrede ist der Sinn klar:
Der Erzähler erzählt, er spricht, also hat er eine Rede.
Doch sobald die Figurenrede ins Spiel kommt, wird es komplizierter …
Denn diese hat eine doppelte Funktion:
- Sie unterstützt die Erzählerrede bei der Wiedergabe der Handlung.
Die Figuren besprechen Ereignisse, treffen Entscheidungen, stellen kausale Verbindungen her, tauschen Hintergrundinformationen aus … und so weiter. - Sie charakterisiert die Figuren und ggf. auch ihre Beziehungen zueinander.
Ihre Wortwahl und Syntax, worauf sie achten, wie sich ihr Ton gegenüber unterschiedlichen Gesprächspartnern verändert … All das gibt uns Aufschluss darüber, wer sie sind, was für einen Hintergrund sie haben und wie sie untereinander vernetzt sind.
Durch eine Figuralisierung der Erzählerrede wird der Erzähler außerdem (scheinbar) in den Hintergrund gerückt und das Innenleben der Figur in den Vordergrund. Dadurch kann der Leser direkt an den Gedanken und Gefühlen der Figur teilhaben, sich emotional anstecken lassen, mitfühlen und mitfiebern. Außerdem geht die Figuralisierung oft mit der eingeschränkten, subjektiven Perspektive der Figur einher und damit auch mit einem eingeschränkten Wissenshorizont:
- Was die Figur nicht weiß, weiß auch der Leser nicht.
- Ist die Figur überrascht, ist es auch der Leser.
- Irrt sich eine Figur, hinterfragen es die meisten Leser nicht.
- Und so weiter …
Wie viel Erzählerrede und wie viel Figurenrede man in seine Geschichte einbindet, hängt sehr stark mit der Wahl der Erzählperspektive zusammen. An dieser Stelle verweise ich auf meine beiden Artikel, in denen ich die erzähltheoretischen Modelle von Stanzel und Genette „verunstaltet“ habe, um aus ihnen ein Werkzeug für die Wahl einer passenden Erzählperspektive zu machen. Klickt doch mal vorbei uns sagt mir, ob meine „Verunstaltungen“ etwas taugen!


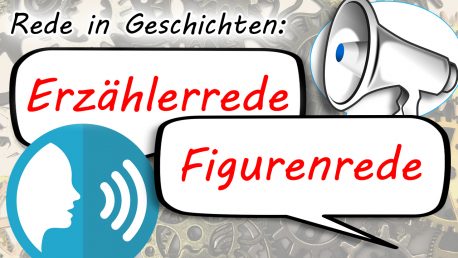
Absolut hilfreich! Vor allem durch die Beispiele!! Dankeschön
Danke sehr fürs Lob!
Eine Lösung meiner Frage habe ich hier nicht gefunden. Es geht um Folgendes:
Er nahm sein Tagebuch zur Hand und schrieb:
Ich traf sie unten am Fluss.
„Hallo“, begrüßte sie mich (( anstelle von „Hallo, begrüßte sie ihn“ )).
* Oder setzt man in der Ichform keine Anführungsstriche:
Hallo, begrüßte sie mich.
Oder schreibt man es mit Apostroph: ‚Hallo‘, begrüßte sie mich.
Also was ist richtig: mit Anführungszeichen oder mit Apostroph oder ohne Zeichen?
Das ist ein Fall von wörtlicher Rede innerhalb von wörtlicher Rede.
Grundsätzlich wird wörtliche Rede in Anführungszeichen gesetzt, die Erzählperspektive (ob Ich-Erzähler oder nicht) ist dabei egal:
Ich traf sie unten am Fluss.
„Hallo“, begrüßte sie mich.
Bei wörtlicher Rede innerhalb von wörtlicher Rede setzt man jedoch einfache Anführungszeichen:
Er nahm sein Tagebuch zur Hand und schrieb:
„Ich traf sie unten am Fluss.
‚Hallo‘, begrüßte sie mich.“
Ich hoffe, ich konnte helfen. 🙂
Guten Morgen,
auch ich habe hier fleißig gelesen und bin immer noch unsicher. Über Hilfe freue ich mich.
Die wörtliche Rede im Erzähltext immer mit neuer Zeile, so wie bei Deiner Antwort im oberen Beispiel?
„Wer bist du?“, frage ich sie, „und, wo bin ich?“
Meine Zunge schmerzt, als ich spreche und mit dem Schmerz dringen immer mehr Erinnerungen in mein Bewusstsein.
„Sage doch etwas!“
Erwartungsvoll schaue ich zu ihr.
oder;
„Wer bist du?“, frage ich sie, „und, wo bin ich?“ Meine Zunge schmerzt, als ich spreche und mit dem Schmerz dringen immer mehr Erinnerungen in mein Bewusstsein. „Sage doch etwas!“ Erwartungsvoll schaue ich zu ihr.
oder;
„Wer bist du?“, frage ich sie, „und, wo bin ich?“
Meine Zunge schmerzt, als ich spreche und mit dem Schmerz dringen immer mehr Erinnerungen in mein Bewusstsein. „Sage doch etwas!“ Erwartungsvoll schaue ich zu ihr.
Mein Manuskript ist größer und ich habe bereits dreimal geändert. Bin unsicher.
Mir fehlt hier die richtige Grundlage. Viele Grüße Gabriele
Moin Gabriele!
Grundsätzlich sind die Absätze Dir selbst überlassen. Was ich allerdings dringend empfehle, ist das Beginnen eines neuen Absatzes beim Sprecherwechsel. Also nicht grundsätzlich bei wörtlicher Rede, sondern wenn eine andere Figur zu reden anfängt. Aber natürlich kannst Du auch beim selben Sprecher neue Absätze beginnen, wenn Du es für sinnvoll erachtest.
Was Deine Varianten angeht, so sind sie alle valide, bloß fällt die Schwerpunktverteilung etwas unterschiedlich aus. Immerhin, wenn Du eine bestimmte Information in einen gesonderten Absatz packst, dann hebst Du sie hervor. Generell signalisierst Du durch die Absatzverteilung eine bestimmte Struktur, die sich auf die unterbewusste Wahrnehmung des Texts durch den Leser auswirkt.
In diesem Zusammenhang könnten Dich mein Artikel über die Wiedergabe von Handlung, inklusive Aufbau von Absätzen (https://die-schreibtechnikerin.de/literaturwissenschaft-definitionen-modelle/erzaehltheorie/wiedergabe-von-handlung/) sowie über Dialoge (https://die-schreibtechnikerin.de/tipps/schreibtipps/tipps-fuer-bessere-dialoge/) interessieren.
So viel dazu. Als kleinen Hinweis nebenbei möchte ich nur noch auf einen Fehler hinweisen:
„Wer bist du?“, frage ich sie, „und, wo bin ich?“
„Wer bist du?“ ist ein abgeschlossener Satz innerhalb der wörtlichen Rede, „frage ich sie“ ist der dazugehörige Begleitsatz. Zusammen ergeben sie einen vollständigen Satz, weswegen nach „sie“ ein Punkt stehen sollte. „[U]nd, wo bin ich?“ ist somit sowohl generell als auch innerhalb der wörtlichen Rede ein neuer Satz und sollte mit einem Großbuchstaben beginnen. Wenn Du aber alles in einem einzigen Satz haben möchtest, kannst Du das erste Fragezeichen auch weglassen. Dann würde ich aber auch auf das Komma hinter dem „und“ verzichten, weil das „und“ dann ja als Konjunktion zwischen zwei Hauptsätzen fungiert. Also entweder:
„Wer bist du?“, frage ich sie. „Und, wo bin ich?“
(Wörtliche Rede = zwei Sätze: „Wer bist du? Und, wo bin ich?“)
oder:
„Wer bist du“, frage ich sie, „und wo bin ich?“
(Wörtliche Rede = ein Satz: „Wer bist du und wo bin ich?“)
Auch hier setzt Du mit jeder Variante bestimmte Akzente, musst also selbst entscheiden, was besser passt.
Liebe Grüße
Feael
Als Erstes wünsche ich Dir ein Frohes Neues Jahr 2023.
Möge es viele gute Chancen für Dich bereithalten.
Vielen herzlichen Dank für Deine ausführliche Antwort. Das hilft mir sehr.
Besonders auch der Hinweis auf die Prüfung der Begleitsätze. Das ist sicher auch ein Nebenprodukt der Umgangssprache bei mir, die dann in Texte einfließt.
Daaaankeschön, auch für Deine Mühe hier zu antworten.
Hast Du auch einen Tipp für eine erfolgreiche Verlagssuche?
Herzliche Grüße Gabriele
Vielen Dank für die Wünsche und gleichfalls!
Über Verlage und zum Thema Veröffentlichung generell geht es im entsprechenden Artikel. Du findest ihn unter diesem Link. Ich hoffe, er ist hilfreich. 🙂
Vielen Dank für die tolle Erklärung! Ich hätte dazu eine Frage.
Ist der innere Monolog immer in der 1. Person geschrieben? Dann ist der Unterschied der erlebten Rede zum inneren Monolog nur die Person und der Tempus, oder?
Wäre dann folgender Satz eine erlebte Rede, auch wenn die Figur (nicht eindeutig erkenntlich) zu einer anderen Figur spricht:
Fritzchen saß an Lischens Bett und versuchte, sie zum Leben zu überreden. Sie möge doch endlich aufwachen, sie solle ihn doch nicht alleine lassen, in dieser schweren Zeit.
Oder wäre das schon als indirekte Rede einzuordnen? Ich hoffe die Frage war verständlich.
Es freut mich, wenn meine Erklärung hilfreich ist. 🙂
Ja, der innere Monolog ist der wörtliche Gedankenstrom einer Figur, deswegen ist er (in der Regel) auch in der 1. Person Singular geschrieben (außer die Figur spricht von sich in der 3. Person oder hat ähnliche Besonderheiten). Die erlebte Rede ist da sehr ähnlich, ja. Allerdings ist das Tempus kein Kriterium, weil erlebte Rede ja auch in eine Erzählung im Präsens eingebettet werden kann. Also: Der innere Monolog ist eigentlich immer im Präsens, bei der erlebten Rede richtet sich das Tempus nach der generellen Zeitform der Erzählung.
Bei Deinem Beispielsatz handelt es sich um indirekte Rede: Fritzchen spricht zu Lieschen, das wird eindeutig gesagt, doch statt einer wörtlichen Wiedergabe des Gesprochenen fasst der Erzähler es zusammen.
Vielen Dank, das hat es verständlich gemacht!
Liebe Grüße
Hallo, vielen Dank für den Artikel, ich lerne gerade fürs Abitur und das war sehr hilfreich! Nur eine Frage blieb offen. Wie heißt es, wenn jemand in einer wörtlich erzählten Geschichte die Figuren in direkter Rede sprechen lässt? Also:
Herr K. sprach über die Unart, erlittenens Leid stillschweigend in sich hineinzufressen, und erzählte folgende Geschichte: „Einen vor sich hin weinenden Jungen fragte ein Passant nach dem Grund des Kummers. Ich hatte 2 Grischen für das Kinobeisammen, da kam ein Kunge und klaute sie mir. Hast du nicht um Hilfe gerufen?… und dann geht es so weiter. Gibt es darauf auch eine Antwort?
vielen vielen Dank und liebe Grüße!
Ich freue mich, wenn ich helfen konnte. 🙂
Wörtliche Rede in wörtlicher Rede ist wörtliche Rede in wörtlicher Rede. Für sie gelten dieselben Regeln wie für die „normale“ wörtliche Rede, bloß benutzt man statt doppelten Anführungszeichen einfache. Ungefähr so:
Herr K. sprach über die Unart, erlittenens Leid stillschweigend in sich hineinzufressen, und erzählte folgende Geschichte:
„Einen vor sich hin weinenden Jungen fragte ein Passant nach dem Grund des Kummers.
‚Ich hatte 2 Grischen für das Kinobeisammen, da kam ein Kunge und klaute sie mir‘, sagte der Junge.
‚Hast du nicht um Hilfe gerufen?‘, fragte der Passant weiter.
…“
Bei diesem Beispiel habe ich noch ein paar Begleitsätze hinzugefügt, um zu demonstrieren, dass die Regeln wirklich haargenau dieselben sind.
Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen verständlich erklären.
Liebe Gabriele,
Vielen Dank für deine ausführlichen Erklärungen und Hinweise auf deiner Webseite hier. Ich schreibe selbst und gerate bei einer bestimmten Sache immer wieder in Diskussionen mit anderen Schreibern, ohne dass wir eine richtige Lösung finden, da wir alle eher von einem Sprachgefühl ausgehen, als es wirklich zu wissen.
Folgendes: Ich schreibe üblicherweise in Präsens. Dabei bediene ich mich sehr oft der erlebten Rede, um die Innenwelt meiner Figuren zu beschreiben. Eben bei der erlebten Rede falle ich stets zurück ins Präteritum. So fühlt es sich für mich einfach richtig an (auch weil es noch einmal die Gedanken von dem eigentlichen Geschehen trennt).
Beispiel: Marie blickt auf ihre Uhr und erstarrt. Oh Gott! Sie war viel zu spät dran! Sie kam zu spät zu ihrem Termin! Hals über Kopf beginnt sie zu rennen.
Für mich klingt es so richtig, andere meinen rein Präsens wäre richtiger.
Was sagst du dazu?
Beste Grüße
Ulrike
Huch, mein Name ist nicht Gabriele. Das ist ein schöner Name, aber ich heiße Katha. Oder Feael Silmarien. Meistens höre ich auch auf „du da“. 😉
Zu Deinem Anliegen: Der Wechsel zwischen Präsens und Präteritum ist falsch. Bei der erlebten Rede übernimmt der Erzähler zwar die Innenwelt einer Figur, aber es ist immer noch der Erzähler, der spricht. Wenn der Erzähler also im Präsens erzählt, dann muss die erlebte Rede auch im Präsens stehen. Es ist eben auch der Sinn und Zweck von erlebter Rede, dass die Gedanken und die Handlungen verschmelzen und auf den ersten Blick nicht zu unterscheiden sind. Wenn Du Gedanken klar hervorheben möchtest, solltest Du die direkte Rede wählen.
Dass der Wechsel zwischen Präsens und Präteritum sich für Dich richtig anfühlt, könnte daran liegen, dass Du beides aus der Literatur kennst: Erzählen im Präsens und erlebte Rede im Präteritum. Du wirst aber wohl kaum beides gleichzeitig im selben Buch angetroffen haben.
Hallo Katha,
Erstmal bitte ich vielmals um Entschuldigung 🙈. Da habe ich mich wohl oben von den Fragen verwirren lassen.
Danke für dein Feedback. Ich denke auch, dass ich es so oft und viel gelesen habe. Es gibt halt eher wenige Bücher, die in Präsens geschrieben sind.
Vielleicht probiere ich es einfach mal eine Story in der Vergangenheit zu schreiben. Mal sehen, wie sich das anfühlt. 😅
LG
Ulrike
Absolut kein Problem wegen der Verwirrung. Fand ich nur witzig. 🙂
Viel Erfolg beim Experimentieren!
Hallo liebe Schreibtechnikerin,
danke für den sehr informativen Text! Ich habe aber noch eine kleine Frage zu einem Satz wie diesem hier mit „Äußerungsverb“ + Indikativ:
Alles in allem, dachte Julia, war ihr Vorschlag doch sehr gut gewesen.
Ist dieser Satz indirekte oder erlebte Rede oder doch etwas anderes?
Liebe Grüße, Marie
Vielen lieben Dank fürs Lob!
Zur Frage:
Indirekte Rede wäre: „Alles in allem, dachte Julia, sei ihr Vorschlag doch sehr gut gewesen.“
Wichtig ist hier der Konjunktiv. Dein Satz hingegen kommt ohne Konjunktiv aus. Ich würde daher sagen, dass es sich um erlebte Rede handelt. Der Begleitsatz „dachte Julia“ ist hier eigentlich auch nicht notwendig bzw. eher dekorativ und wirkt eher wie ein Einschub.
Hallo Schreibtechnikerin
Zunächst einbmal vielen Dank für diesen aufschlussreichen Text!
Ich meine, ich hätte mal in einem Buch eine Stelle gelesen, in der zwar eine direkte Rede vorkommt. Jedoch wird die direkte Rede durch Kommentare des Erzählers unterbrochen, weil die Figur während des Sprechens eine Bewegung macht. Das ganze sah beispielsweise wie folgt aus:
„Ich habe (sie fasste sich an den Kopf) ganz schlimme Kopfschmerzen.“
Ist das so korrekt oder habe ich da etwas falsches im Kopf?
Liebe Grüsse, Michael
Hallo Michael,
vielen Dank fürs Lob!
Die wörtliche Rede kann durchaus von Handlungen unterbrochen werden, bloß macht man das nicht mit Klammern, sondern so:
„Ich habe“, sie fasste sich an den Kopf, „ganz schlimme Kopfschmerzen.“
Ich hoffe, ich konnte helfen.