Früher oder später musst Du dem Leser Dein World-Building erklären. Dabei ist sogenanntes Info-Dumping, erklärende Frontalvorträge, bekanntermaßen eine schlechte Idee. – Aber wie machst Du es besser? Welche Methoden gibt es, um dem Leser die notwendigen Informationen näherzubringen, und welche Tricks kannst Du dabei anwenden? Darum geht es in diesem Artikel.
Die Folien für dieses Video gibt es für Steady-Abonnenten und Kanalmitglieder auf YouTube als PDF zum Download.
So genial Der Herr der Ringe von J. R. R. Tolkien auch ist – die Einführung dieses Klassikers ist berüchtigt. Ein guter Teil der Leserschaft überspringt sie sogar einfach: Denn diese Menschen wollen die Geschichte lesen und keinen fiktional-wissenschaftlichen Aufsatz über Pfeifenkraut.
Wir lernen also:
Sofern Du nicht J. R. R. Tolkien heißt, solltest Du dem Leser keine fiktional-wissenschaftlichen Aufsätze um die Ohren hauen.
Solche Frontalvorträge, in denen einfach nur erklärt wird, wie die fiktive Welt funktioniert, ansonsten aber nichts passiert, nennt man Info-Dump. Und in 99 % aller Fälle ist dermaßen lieblos hingeknallter Info-Dump eher abschreckend. Deswegen stellt sich die Frage:
Wie sollen wir unseren Lesern erklären, wie die Welt in einer Geschichte funktioniert, ohne sie zu überfordern?
Das besprechen wir in diesem Artikel.
Direkte und indirekte Exposition
Wenn Du hier schon etwas länger dabei bist, dann kennst Du sicherlich den alten Artikel, in dem wir uns schon einmal mit diesem Thema befasst haben. Aber weil der Artikel, wie gesagt, schon alt ist und ich das Ganze ohnehin etwas strukturierter darstellen möchte, wagen wir hiermit einen neuen Anlauf und reden zunächst über direkte und indirekte Exposition:
- Unter direkter Exposition verstehen wir frontale Erklärungen, wie die Welt funktioniert, wie die Vergangenheit der Figuren aussieht etc.
- Unter indirekter Exposition verstehen wir eine Darstellung der Funktionsweise der Welt, der Vorgeschichten der Figuren etc., die eher subtil stattfindet.
Was meine ich aber damit?
- Wenn der Erzähler einen langen Vortrag darüber hält, wer bzw. was Holomisuhasitams sind, wo sie herkommen, was sie fressen und so weiter, dann ist das eine sehr direkte Exposition. Solche Passagen sind im Grunde Lexikonartikel zu einem Thema, von dem man nicht weiß, warum es einen überhaupt interessieren sollte.
- Nun kann der Erzähler einen solchen Vortrag auch einer Figur in den Mund legen: Dann ist es eben Prof. Dr. Fritzchen, der seine Studenten – und nebenher auch den Leser – über Holomisuhasitams aufklärt. Das ist meistens genauso unspannend wie der Lexikonartikel.
Das Problem bei solchen Vorträgen besteht darin, dass die Erzählung pausiert: Es passiert einfach nichts, die Geschichte steht still, während der Kopf des Lesers mit nackten Informationen vollgestopft wird. Wenn Du das Ganze also dynamischer gestalten möchtest, kannst Du Exposition und Handlung verbinden:
- Wenn in der Geschichte eine Invasion der Erde durch Holomisuhasitams stattfindet, schweben die Hauptfiguren in Lebensgefahr: Es gibt also einen Konflikt, jede Menge Fragezeichen, der Leser fiebert mit und will Antworten und Lösungen. Und da kommt nun Prof. Dr. Fritzchen daher und gibt in spannungsgeladenen Dialogen kurze, auf das Relevante reduzierte Antworten und Lösungsmöglichkeiten, die die Hauptfiguren wiederum vor Entscheidungen stellen, für die sie noch mehr Informationen über Holomisuhasitams brauchen. Bei diesem Ansatz werden die Informationen also nicht einfach hingeknallt, sondern sie liefern ersehnte Antworten und treiben den Plot voran.
- Eine noch weniger aufdringliche Form des World-Buildings wäre, das Wesen der Holomisuhasitams in Aktion zu zeigen, ganz nach dem Prinzip: „Show, don’t tell!“. Wenn ein Holomisuhasitam zum Beispiel einen Menschen mit Haut und Haaren verschlingt, dann wissen die Figuren und mit ihnen auch die Leser schon mal, wovon sie sich ernähren.
Nun habe ich aber einige dieser Ansätze als positiver dargestellt als andere. Ich möchte allerdings betonen, dass das lediglich Tendenzen sind, die „nur“ in gefühlt 99 % aller Fälle zutreffend sind. Denn Ausnahmen gibt es immer und wenn Prof. Dr. Fritzchen zum Beispiel einen genialen Sinn für Humor hat und sein Frontalvortrag mich zum Lachen bringt, lese ich ihn sehr, sehr gerne.
„Show“ und „Tell“
Ansonsten wird Dir, wenn Du die Welt der Literatur beobachtest, auffallen, dass all diese Ansätze in der Regel miteinander kombiniert werden. Auch wenn man normalerweise „Show, don’t tell!“ sagt, hat „Tell“ seinen rechtmäßigen und äußerst wichtigen Platz im Storytelling. Eben weil man dabei sehr viel Information auf sehr wenig Raum unterbringen kann, eignet sich „Tell“ zum Beispiel für Informationen, die nicht unbedingt von zentraler Bedeutung sind und somit keine gesonderte Szene rechtfertigen:
Wenn es in der Geschichte also beispielsweise nicht um eine Invasion von menschenfressenden Holomisuhasitams geht, die Information über ihre Ernährung aber trotzdem irgendwie wichtig ist, brauchst Du keine ganze Szene, in der ein Holomisuhasitam einen Menschen frisst. Im Gegenteil, „Show“ um des „Show“ willen, wenn eine Szene nichts weiter tut, als eine semi-wichtige Information zu vermitteln, dann ist sie ein reiner Filler und wird den Leser eher nerven. Daher bist Du in diesem Fall besser beraten, wenn Du Prof. Dr. Fritzchen einfach sagen lässt: „Holomisuhasitams fressen Menschen.“
Bei der Entscheidung, ob Du eine Information direkt oder indirekt durch „Show“ oder „Tell“ vermittelst, spielt die Relevanz also eine wesentliche Rolle – und mit der Relevanz auch die Prämisse und der zentrale Konflikt. Die Faustregel lautet dabei:
Was von zentraler Bedeutung ist, sollte durch eine prägnante Szene gezeigt werden.
Was nicht von zentraler Bedeutung ist, kann durch einfaches „Tell“ abgeknuspert werden.
Wenn Du Dich für „Tell“ entscheidest, musst Du aber auch hier auf die Relevanz achten und den Frontalvortrag auf das Wesentliche reduzieren.
Besonders schön kommt dieser Punkt in einem Video-Essay von Pentex Productions rüber, in dem die Prologe vom Herrn der Ringe von Peter Jackson und vom Herrn der Ringe von Ralph Bakshi verglichen werden. Einer der Gründe, warum der Jackson-Prolog funktioniert und der von Bakshi nicht, ist, dass Peter Jackson aus seinem Prolog alles gestrichen hat, was der Zuschauer ganz am Anfang noch nicht zu wissen braucht. Bestimmte Einzelheiten wie zum Beispiel Elronds Versuch, Isildur zum Zerstören des Einen Rings zu bewegen, oder Sméagols Vorgeschichte, werden erst später an passenden Stellen ergänzt. Bakshi hingegen hat gefühlt alles, was es an Vorgeschichte zu wissen gibt, in einen viel zu langen und langatmigen Prolog gequetscht – weswegen sein Film direkt mit Langeweile beginnt.
Ob eine zu vermittelnde Information von essentieller Bedeutung ist, also „Show“ erfordert, erkennst Du übrigens unter anderem daran, dass sich bei wirklich essentiellen Dingen konkrete Szenen zum „Showen“ nahezu von selbst aufdrängen – eben weil sie direkt an die Prämisse und den zentralen Konflikt gekoppelt sind.
Wenn wir also zu unserer Holomisuhasitam-Invasion zurückkehren und die Bedrohung durch diese menschenfressenden Aliens den zentralen Konflikt darstellt, wirst Du kaum umhin können, als einen Holomisuhasitam in einer konkreten Szene einen Menschen verspeisen zu lassen. Oder Prof. Dr. Fritzchen und sein Team finden die Überreste einer solchen Mahlzeit. Aber so oder so wirst Du ja Atmosphäre und Angst vor den Aliens aufbauen müssen und das kannst Du eben mit der Vermittlung von Informationen kombinieren.
Die Rolle der Erzählperspektive
Nun spielt es vor allem, aber nicht nur in Fantasy und Science Fiction auch eine Rolle, ob die Reflektorfigur sozusagen zu den Eingeborenen der fiktiven Welt gehört oder nicht. Genauer gesagt: ob sie sich in der fiktiven Welt auskennt oder nicht.
Um es mal ganz simpel zu erklären:
- Wenn die Reflektorfigur sich in der fiktiven Welt nicht auskennt, dann hat sie denselben Kenntnisstand wie der Leser. Und ebenso wie der Leser will sie Antworten. Es ist also ganz natürlich, wenn sie – stellvertretend für den Leser – Fragen stellt und sich Vorträge anhört.
- Wenn die Reflektorfigur hingegen sich in der fiktiven Welt bestens auskennt, gibt es eine Diskrepanz zwischen dem Kenntnisstand der wissenden Figur und dem des unwissenden Lesers. Der Leser stellt sich also Fragen, die die Figur niemals stellen würde. – Wie beantwortet man in einem solchen Fall also die Fragen des Lesers, ohne dass es unnatürlich wirkt?
Ungeschickte Autoren ignorieren diese Problematik einfach und greifen auf das nervige Phänomen der As-you-know-Erzählsituationen zurück: also Szenen, in denen Figuren sich gegenseitig Dinge erklären, über die sie bereits bestens Bescheid wissen. Auch wenn in solchen Gesprächen möglicherweise durchaus wichtige Informationen vermittelt werden, lesen sie sich so logisch und elegant wie wenn ein Tierarzt zum anderen sagt: „Wie du ja weißt, sind Hunde Vierbeiner und haben somit eine andere Anatomie als wir Menschen …“ – Absurd, oder? Deswegen macht es auch wenig Sinn, wenn Prof. Dr. Fritzchen in unserer Geschichte Prof. Dr. Lieschen, die schon ihr ganzes Leben lang Holomisuhasitams erforscht, über die Ernährungsgewohnheiten von Holomisuhasitams aufklärt.
Ein funktionales, aber meistens ungeschicktes Mittel, wichtige Erklärungen für den Leser einzubauen, ist, die Erklärungen einfach direkt von der Erzählinstanz info-dumpen zu lassen: „Es war einmal der Planet Furzevick, und dort lebten menschenfressende Holomisuhasitams …“ – Wie gesagt, es gibt Ausnahmen, in denen solches frontales Info-Dumping interessant sein kann, aber in 99 % der Fälle ist es das eben nicht. Und wenn man auch keine Reflektorfigur hat, die Fragen stellen kann …
Indirekte Exposition in Dialogen
… kann man oft auf Nebenfiguren zurückgreifen. Denn ja, Prof. Dr. Lieschen braucht keine Aufklärung über Holomisuhasitams. Aber Generalleutnant Kläuschen, dessen Soldaten die Invasion stoppen müssen, hat von diesen Kreaturen keine Ahnung. Deswegen müssen Prof. Dr. Fritzchen und Prof. Dr. Lieschen ihm alles verständlich, aber trotzdem kurz erklären – denn die Zeit drängt. Dafür kann Generalleutnant Kläuschen den beiden nerdigen Wissenschaftlern zeigen, wie Plasmapistolen funktionieren. – Und schon kennt sich der Leser in gleich mehreren Fachbereichen der fiktiven Welt aus.
Aber nun erhöhen wir den Schwierigkeitsgrad und streichen Generalleutnant Kläuschen aus der Geschichte. Die Informationsvermittlung muss also zwangsweise in einem Gespräch zwischen Prof. Dr. Fritzchen und Prof. Dr. Lieschen erfolgen. – Was tun wir?
Dass beide Gesprächspartner sich mit der Materie auskennen, bedeutet nicht automatisch, dass sie allgemein bekannte Dinge nicht trotzdem ansprechen können. Sie würden sich gegenseitig keine Frontalvorträge halten, aber das Ansprechen bekannter Tatsachen, um einen Gedanken zu untermauern, ist durchaus natürlich. Zum Beispiel, wenn Prof. Dr. Fritzchen und Prof. Dr. Lieschen einen einzelnen Holomisuhasitam sichten und eine Diskussion beginnen, ob sie wegen eines einzigen, aber trotzdem Menschenfressers schon Alarm schlagen sollen. In dieser Diskussion lassen sich viele Informationen unterbringen, getarnt als Argumente. Und vor allem treiben diese Informationen auch den Plot voran, weil es ja um eine wichtige Entscheidung geht.
Indirekte Exposition in Monologen
Machen wir das Ganze aber noch schwieriger und lassen Prof. Dr. Fritzchen ganz allein nach Lösungen suchen. Ohne Diskussionen mit Prof. Dr. Lieschen lassen sich Informationen nicht einfach mal eben in Dialogen unterbringen. Prof. Dr. Fritzchens einziger Gesprächspartner ist Prof. Dr. Fritzchen selbst. Und wenn wir die Erklärungen nicht direkt durch die Erzählinstanz vermitteln wollen, können gerade wir Prosaisten auf innere Monologe und Gedankenströme zurückgreifen.
Wenn Prof. Dr. Fritzchen auf der Suche nach Lösungsansätzen ist, dann wird er wahrscheinlich nicht einfach nur herumsitzen und grübeln, sondern sich in seinem Labor oder seinen Büchern nach Anregungen umschauen. Und da kann man sowas unterbringen wie zum Beispiel:
Fritzchen schlug das Lexikon auf und überflog den Artikel über Holomisuhasitams. „Stammen vom Planeten Furzevick“, stand da, „… schleimig … schweben einen halben Meter über dem Boden … fressen Menschen …“ – Nichts, was er nicht bereits wusste. Fritzchen wollte das Lexikon also wieder zuklappen, als sein Blick auf die Worte „Siehe auch“ fiel: Einige große Schlachten wurden da aufgezählt. Und ja, wieso nicht? Auch wenn keine der Schlachten gegen Holomisuhasitams erfolgreich gewesen war, konnte er sie doch trotzdem durchstudieren und aus den damaligen Fehlern lernen …
Hier ist das Info-Dumping auf einige wenige Satzfetzen beschränkt, also maximal auf das Wesentliche reduziert, indem gezeigt wird, wie die Reflektorfigur die ihr bekannten Informationen schnell abklappert und beiseiteschiebt. Dabei werden dem Leser aber viele Informationen vermittelt.
Pass also gut auf, wenn Du in einer Geschichte Stellen findest, wo eine Figur einen für sie alltäglichen Sachverhalt beobachtet: Bestimmt geht es hier nicht nur darum, die Innenwelt der Figur darzustellen und/oder Atmosphäre aufzubauen, sondern auch um World-Building.
„Show“ beim World-Building
Bei all diesen Spielereien mit der Erzählperspektive wird Dir aber sicherlich aufgefallen sein, dass es sich um – sei es auch noch so subtiles – „Tell“ handelt. Wie funktioniert aber „Show“?
Die direkte „Show“-Herangehensweise haben wir bereits angeschnitten: Wenn Holomisuhasitams als Menschenfresser dargestellt werden sollen, dann lass einen Holomisuhasitam in einer konkreten Szene einen Menschen fressen. Viel World-Building findet aber auch sehr subtil, ganz nebenher, statt. Dabei handelt es sich meistens nicht um essentielle Informationen, sondern eher um atmosphärische Details, die die fiktive Welt lebendig wirken lassen.
Wie bereits gesagt, solltest Du kein „Show“ um des „Show“ willen betreiben, also Dir nicht für eher irrelevante Details ganze Szenen ausdenken. Ebenso macht es wenig Sinn, diese irrelevanten Details ausführlich zu „tellen“. Sie nur knapp und/oder indirekt zu „tellen“ durch Dialoge oder innere Monologe ist aber durchaus eine Option.
Oder aber Du sprichst diese Dinge gar nicht an, sondern streust stattdessen Hinweise und lässt den Leser selbst mitdenken …
Prinzipien und Hintergründe zeigen
Denn der Leser ist nicht dumm und wenn er zum Beispiel in Tolkiens Hobbit eine Gruppe von Zwergen mit Namen wie Thorin, Balin, Dwalin, Ori, Nori, Dori, Óin, Glóin und so weiter antrifft, dann musst Du ihm nicht noch explizit vermitteln, dass ein Zwerg in diesem Universum nicht gerade Franky heißen würde. Wenn Du Dich außerdem mit altnordischen Namenstraditionen auskennst oder Dir wenigstens den ein oder anderen Zwergenstammbaum mit all den alliterierenden und reimenden Namen angesehen hast,wirst Du Dir selbst denken können, dass Óin und Glóin Brüder sind.
Auch die Namen von Orten können viel erzählen. In meiner Stadt gibt es zum Beispiel eine Straße mit dem Namen „Am Brandende“. – Muss ich Dir da noch extra erzählen, dass die Stadt in ihrer jahrhundertelangen Geschichte ein paar Mal gebrannt und einer der Brände in der Gegend dieser Straße aufgehört hat? In einer Geschichte ließe sich also schon allein durch die Erwähnung eines solchen Straßennamens sehr viel World-Building betreiben.
Wenn Du die Funktionsweise von Gesellschaften nebenher „showen“ möchtest, dann achte darauf, wie die Figuren miteinander interagieren. Gibt es zum Beispiel bestimmte Rituale und Höflichkeitsnormen? In einem früheren Artikel haben wir über Hierarchien und Machtstrukturen gesprochen. Wenn Du also solche Strukturen herausgearbeitet hast, dann zeige sie am Verhalten der Figuren: Wenn während einer Schlacht gegen die Holomisuhasitams alle Figuren die Befehle von Generalleutnant Kläuschen befolgen, dann sagt das etwas über seinen Platz in der Gesellschaft aus. Wenn Generalleutnant Kläuschens Befehle aber mit einem Augenrollen angenommen und nur halbherzig ausgeführt werden, während das Fritzchen-Lieschen-Duo kaum etwas tun muss, damit die anderen seine Ideen umsetzen, zeigt das eine Diskrepanz zwischen Kläuschens formalem Kommandoposten und seiner tatsächlichen Rolle im Kampf mit den Aliens.
Denke daran, dass Menschen grundsätzlich anpassungsfähige Wesen sind. Und Anpassung funktioniert durch Beobachtung. Wenn Du Dir also den Kopf zerbrichst, wie Du irgendwelche Prinzipien und Funktionsweisen darstellst, dann kannst Du auf eigene Erfahrungen zurückgreifen: Denn zwar bereisen wir keine fiktiven Welten, aber jeder kennt es, dass man, wenn man in eine neue Gegend und/oder Gruppe kommt, die Gepflogenheiten darin zunächst einmal auf sich wirken lässt. Man betrachtet die großen und die kleinen Dinge, ahmt die Einheimischen nach und versucht, sie zu verstehen:
Wenn Du zum Beispiel nach Japan kommst, wirst Du keinen Reiseführer gelesen haben müssen, um festzustellen, dass Verbeugungen dort als wichtige Höflichkeitsgeste gelten. Du merkst es einfach, weil die Menschen um Dich herum sich ständig voreinander verbeugen. Und wenn Du ein anständiger, höflicher Mensch bist, beobachtest Du, in welchen Situationen sie es tun, und fängst irgendwann an, Dich in solchen Situationen ebenfalls zu verbeugen.
Genau dasselbe tut der Leser mit der fiktiven Welt in Deiner Geschichte.
Überlege also, welche Dinge Dir auffallen, wenn Du andere beobachtest, und dann hast Du schon mal ein paar Ideen, welche Dinge Du in Deiner Geschichte einfach nebenher einstreuen kannst.
Visuelles zeigen
Manche Dinge sind aber auch rein visuell: Eine Landschaft zum Beispiel kannst Du nicht „in Aktion“ zeigen, weil sie statisch ist. Sie kann höchstens als Metapher für die inneren Vorgänge in der Seele der Reflektorfigur dienen – aber an sich existiert sie einfach und kann nur beschrieben werden.
Ebenso wie „Tell“ laufen allzu ausschweifende Beschreibungen aber Gefahr, zu reinem Info-Dump zu verkommen. Deswegen habe ich in einem früheren Artikel gesagt:
Die besten Beschreibungen sind kurz, knackig und treffen den Nagel auf den Kopf.
Ich meine, wenn Du das seltene Talent hast, besonders ästhetisch, humorvoll oder anderweitig interessant zu beschreiben, und eine solche Beschreibung auch zu Deiner Geschichte und der konkreten Textstelle passt, dann spricht nichts dagegen, dieses Talent zu nutzen. Generell solltest Du aber nicht schwafeln.
Tipps für gute Beschreibungen findest Du übrigens im besagten früheren Artikel. Worauf Du aber außerdem noch achten solltest, ist, wo Du diese Beschreibungen platzierst – denn über eine Landschafts‑, Stadt- oder Was-auch-immer-Beschreibung, die gefühlt aus heiterem Himmel fällt, freut sich niemand. Deswegen sollte eine Beschreibung da auftauchen, wo sie relevant ist: Wenn Deine Figuren zum Beispiel ein Gebirge durchqueren, bietet es sich an, den Leser ihren Blicken folgen zu lassen und mit ihnen zusammen die Berge zu betrachten. Außerdem können gerade Landschaftsbeschreibungen gut in Dialogen untergebracht werden, wenn die Figuren eine Reiseroute, eine Schlacht, den Bau eines Hauses oder Ähnliches planen und dabei die Besonderheiten der Landschaft berücksichtigen müssen.
Wie vorhin kurz erwähnt, können Beschreibungen auch die inneren Vorgänge der Figuren spiegeln oder anderweitig zum Aufbauen einer Stimmung genutzt werden: Wenn Du zum Beispiel eine trostlose Stimmung aufbauen möchtest, lohnt es sich, eine trostlose Umgebung zu skizzieren. Häufig finden sich solche atmosphärischen Beschreibungen am Anfang einer Szene, weil dem Leser ja unter anderem vermittelt werden muss, wo die Szene überhaupt stattfindet – und atmosphärische Beschreibungen lassen sich eben gut an die Nennung des Handlungsortes koppeln.
Und natürlich musst Du eine Sache auch nicht komplett an einer einzigen Stelle beschreiben, sondern es ist sogar durchaus sinnvoll, die Beschreibung häppchenweise zu streuen: Wenn die Stadt Düsterhausen zum ersten Mal erwähnt wird, reicht es sicherlich, wenn die Figuren, die schon mal dort gewesen sind, sich abfällig darüber äußern. Sobald die Reflektorfigur die Stadt zum ersten Mal betritt, kannst Du ausführlicher auf die Düsternis von Düsterhausen eingehen.
Die Magie der Montage
Nicht zuletzt können wir, wenn wir, wenn wir von Subtilität und „Show“ reden, uns auch vom Genre Film inspirieren lassen. In einem früheren Artikel bin ich bereits auf Montagetechniken eingegangen. Diese sind vor allem deswegen interessant, weil sie gerne zusätzliche Bedeutungen erschaffen oder bereits vorhandene Bedeutungen vertiefen.
Zum Beispiel wird in der Verfilmung von Remarques Der Weg zurück von 1937 relativ weit am Anfang zwischen den Kampfhandlungen an der Front und der Unterzeichnung des Waffenstillstands vom 11. November 1918 umhergesprungen. An sich handeln die Szenen an der Front einfach nur von Krieg und Tod. Die Szenen, in denen sich die Delegationen treffen und den Waffenstillstand unterzeichnen, handeln von Verhandlungen und Verträgen. Wenn man zwischen den beiden Schauplätzen aber hin und her schaltet, also eine sogenannte Parallelmontage macht, ergibt sich eine dritte Bedeutung: Während die Laberdiplomaten über die Vertragsbedingungen diskutieren und Papierchen bekritzeln und sich dabei nicht allzu sehr beeilen, ist das Sterben an der Front besonders sinnlos, weil es vor dem Hintergrund des ohnehin verlorenen Kriegs und des anstehenden Waffenstillstands mehr denn je irrelevant ist, ob ein konkreter Schützengraben erobert wird oder nicht.
Durch Montage kannst Du also bestimmte Sachverhalte zeigen, ohne sie explizit zu erklären oder auch nur zu erwähnen. Der Leser zieht seine Schlüsse einfach selbst angesichts der bloßen Kombination und Anordnung der Szenen.
Dabei können Montagetechniken nicht nur auf Szenen, sondern auch auf die Informationsvermittlung innerhalb einer einzigen Szene angewandt werden:
Zum Beispiel gibt es in der Special Extended Edition von Der Herr der Ringe: Die Gefährten eine Szene, in der Aragorn ein Lied summt. Als Frodo ihn über die Figur in diesem Lied ausfragt, erzählt Aragorn in Kurzform die Geschichte von Beren und Lúthien, einer Liebe zwischen Mensch und Elbin. Später stellt sich heraus, dass dabei Aragorns eigene Geschichte angedeutet wurde, weil er als Mensch mit der Elbin Arwen verlobt ist – beide übrigens sogar direkte Nachfahren von Beren und Lúthien. Somit ist diese Szene nicht einfach nur atmosphärisch und zeigt etwas vom Wanderalltag der kleinen Gruppe, sondern die Binnenerzählung charakterisiert Aragorn und ordnet ihn in ein noch viel größeres World-Building ein. Die Szene transportiert also Zusammenhänge, die weder im Dialog zwischen Frodo und Aragorn noch in der Binnenerzählung an sich genannt werden.
Schau Dich also in anderen Gattungen um und lass Dich inspirieren! Denn letztendlich ist Originalität nichts weiter als eine neue Kombination altbekannter Dinge.
Schlusswort
Wie Du siehst, erfordert das Einbinden des World-Buildings in die Geschichte sehr viel Fingerspitzengefühl und Übung. Ich hoffe aber, dass dieser Artikel Dir eine kleine Hilfe sein kann.
Ansonsten möchte ich mal wieder die Wichtigkeit der Zielgruppe ansprechen. Denn jede Zielgruppe hat einen anderen Wissensstand und während Du gegenüber einer Zielgruppe auf ausführlichere Erklärungen verzichten kannst, sind solche Erklärungen gegenüber einer anderen Zielgruppe überlebensnotwendig. Es geht dabei nicht nur um wissenschaftliche Fachbegriffe in Science-Fiction-Settings, sondern auch um Geschichten, die in unserer eigenen Welt, aber dafür in einer bestimmten Kultur, Epoche oder in einem bestimmten Milieu spielen.
Zum Beispiel lesen und verstehen Westeuropäer russische Klassiker wie Krieg und Frieden oft ein wenig anders als Russen, weil ihnen der kulturelle Kontext fehlt, dessen Kenntnis von den Autoren aber selbstverständlich vorausgesetzt wurde. Hätten sie primär für Westeuropäer geschrieben, hätten sie explizite und/oder subtile Erläuterungen eingebaut. Ebenso fällt mir auf, wie sich mein Verständnis von Anime mit zunehmender Kenntnis der japanischen Kultur verändert.
Vergiss also nie, für wen Du Deine Geschichte schreibst, denn daraus ergibt sich auch, welche Teile des World-Buildings Du wie einführen musst.
Und apropos Einführungen: World-Building ist ja gerade am Anfang der Geschichte, wenn der Leser mit der Welt noch gar nicht vertraut ist, von besonderer Wichtigkeit. Doch was macht einen guten Anfang überhaupt aus? Das haben wir in einem früheren Artikel schon besprochen und ich lade Dich herzlich ein, dort vorbeizuschauen.


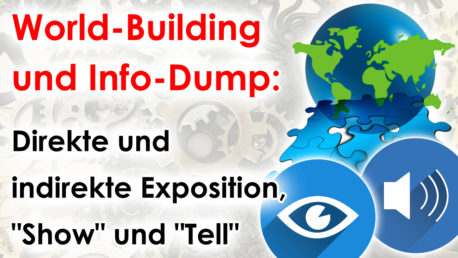
Eigentlich hatte ich Lust, den Beitrag ganz zu lesen, weil er interessante Ausführungen zu bieten versprach. Leider werden in dem Beitrag zu viele Absolutismen verwendet oder auch steuernde Suggestivfragen(Beispiel: „(…) Lexikonartikel zu einem Thema, von dem man nicht weiß, warum es einen überhaupt interessieren sollte.“) Dieses Vorgehen durchzieht den gesamten Text, soweit ich beim Querlesen feststellen konnte. Was also eine anregende Einführung in den Gegenstand „Worldbuilding“ sein könnte, wird in meinen Augen zum Vortrag einer vermeintlichen „Autorität“, deren Expertise offenbar nicht hinterfragt werden soll. Schade!
Vielen Dank fürs Feedback!
Wenn Du meine „Autorität“/Expertise hinterfragen möchtest, dann gerne – was wäre sonst der Sinn dieses Kommentarbereichs? Ich weiß nicht, ob es Dir beim Querlesen aufgefallen ist, aber ich tendiere praktisch immer dazu, meine Bewertungen und Empfehlungen zu relativieren, betrachte meine Ansichten also nicht als das Non plus ultra, sondern höchstens nur als Ergebnis jangjähriger empirischer Beobachtung von Tendenzen. Wenn Du einige der von mir beobachteten Tendenzen anders siehst, wäre ein Austausch sicher bereichernd.
Ich verstehe diesen Einwand nicht. Der Artikel gibt einem eine sehr gute Einführung in das Thema und erklärt, welche Ansätze schnell zu Langeweile führen, sogar unnatürlich wirken, und wie man relevante Informationen direkt, indirekt oder subtil einbringen kann.
Würde hingegen da stehen, dass man machen kann, was man will, und alles irgendwie schon passt, dann würde es ja gar nichts bringen, diesen Aritkel zu lesen.
Es geht hier um Technik. Das ist wie beim Handwerk. Zuerst lernt man, den Hobel richtig herum zu halten, bevor man versucht, ihn für irgendetwas Kreatives zu misbrauchen. Und letzteres müssen auch die wenigsten je tun, um kreativ zu sein.