Kann man den Leser zum Protagonisten der Handlung machen? Schließlich dienen doch viele Geschichten dem Eskapismus und entführen den Leser in ein alternatives Leben. In der Regel funktioniert das durch Empathie bzw. das Hineinversetzen in eine fiktive Figur. Aber kann man den Leser nicht auch direkt in die Geschichte holen? Mit einem „Du-Erzähler“? In diesem Artikel reden wir über den Sinn und Unsinn dieser Erzählweise.
Die Folien für dieses Video gibt es für Steady-Abonnenten und Kanalmitglieder auf YouTube als PDF zum Download.
Erzählen in der 1. und 3. Person ist Gang und Gäbe. Aber was ist mit der 2. Person? Was ist mit dem Erzähler, der den Leser direkt anspricht und ihn zum Protagonisten der Handlung macht?
Der Wunsch für dieses Thema stammt aus der KreativCrew und hatte die Begründung: „da sie [die ‚Du-Perspektive‘] so selten ist“. Und es wurde auch gleich ein zentrales Problem dieses Erzählers angesprochen: „Wieso funktioniert diese Perspektive eher weniger?“ Später, als die KreativCrew Detailwünsche zu diesem Thema äußern konnte, sprach aus den Beiträgen überwiegend Unverständnis, warum man sich für eine solche Erzählweise entscheiden sollte. Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass auch Du gerade ein großes, dickes Fragezeichen im Kopf hast.
Kümmern wir uns also um dieses Fragezeichen:
Was passiert, wenn man einen „Du-Erzähler“ wählt? Wann macht er Sinn? Und warum ist er meistens eine schlechte Wahl?
Das besprechen wir in diesem Artikel.
„Du-Perspektive“: Wo sie funktioniert
Obwohl ein „Du-Erzähler“ auf den ersten Blick ungewöhnlich anmutet, kennen wir ihn tatsächlich aus unserem Alltag. Und in dieser Alltagsfunktion taucht er manchmal auch in Binnenerzählungen von fiktionalen Werken auf – beispielsweise in Remarques Der Weg zurück, als der junge Protagonist der Erzählung seines älteren Kriegskameraden Adolf Bethke lauscht. Dessen Ehe ist zerbrochen und er fühlt sich ohne seine Frau einsam:
„Er schiebt mir eine Schüssel mit Obst hin. «Willst du einen Apfel?» Ich nehme einen und biete ihm eine Zigarre an. Er beißt die Spitze ab und fährt fort: «Sieh, Ernst, ich hab hier gesessen und gesessen und bin halb verrückt dabei geworden. Wenn du allein bist, ist so ein Haus was Schreckliches. Du gehst durch die Zimmer – da hängt noch eine Bluse von ihr, da sind ihre Nähsachen, da ist der Stuhl, auf dem sie immer saß und nähte – und abends, da steht das zweite Bett so weiß und verlassen neben dir herum, du siehst alle Augenblicke ‚rüber und wälzst dich hin und her und kannst nicht schlafen – da geht dir manches durch den Kopf, Ernst -»“
Erich Maria Remarque: Der Weg zurück, Fünfter Teil, II.
Adolf Bethke sagt „du“ und spricht den Protagonisten direkt an – aber er meint dabei nicht ihn, Ernst, sondern sich selbst. Mit dem „du“ fordert Adolf seinen Freund eher indirekt auf, sich in seine Lage zu versetzen, und suggeriert auch, dass es jedem in seiner Situation so gehen würde wie ihm.
Es ist also ein „Du-Erzähler“, der in Wirklichkeit kein „Du-Erzähler“ ist, weil ja gar nicht der Angesprochene gemeint ist. Und das ist auch der Grund, warum dieser „Du-Erzähler“ sich nicht merkwürdig oder unnatürlich anfühlt.
In eine ähnliche Richtung geht auch der „Du-“ bzw. „Höflichkeitsplural-Sie-Erzähler“ in „Sewastopol im Dezember“, der ersten Erzählung von Lew Tolstojs Sewastopol-Zyklus, in dem der damals noch junge Autor seine Erfahrungen während des Krimkrieges verarbeitet hat. Hier nimmt der Erzähler den Leser mit auf eine Art Sightseeing-Tour durch die umkämpfte Stadt. Eine der Stationen ist dabei das Lazarett:
„Sie gehen zwischen den Betten hindurch und halten Ausschau nach einem weniger strengen und leidenden Gesicht, an das sie heranzutreten wagen, um zu sprechen.
‚Wo bist du verwundet?‘, fragen Sie unentschlossen und zaghaft einen alten, abgemagerten Soldaten, der auf seiner Pritsche sitzt, Sie mit gutmütigem Blick beobachtet und Sie einzuladen scheint, an ihn heranzutreten. Ich sage: ‚zaghaft fragen Sie‘, weil Leiden, abgesehen von tiefem Mitgefühl, aus irgendeinem Grund auch die Furcht einflößen zu beleidigen sowie Hochachtung vor dem, der sie ertragen hat.
‚Am Bein‘, antwortet der Soldat; – doch in genau diesem Moment bemerken Sie selbst anhand der Falten der Bettdecke, dass er oberhalb des Knies kein Bein mehr hat.“
Lew Tolstoj: Sewastopoler Erzählungen, Sewastopol im Dezember.
Im Gegensatz zur Erzählung von Adolf Bethke ist mit diesem „Du-Erzähler“ tatsächlich der Leser gemeint. Allerdings geht es nicht um Dinge, die dem Leser tatsächlich zustoßen, sondern es handelt sich um ein Gedankenspiel: Tolstoj lädt den Leser ein, sich in die Lage von jemandem zu versetzen, der Sewastopol im Dezember 1854 erlebt, und führt ihn durch eine Reihe typischer Szenen, Interaktionen, Eindrücke und Gefühle.
Somit geht es auch hier nicht wirklich um den Leser als Figur, sondern um eine Einladung, sich in eine Situation hineinzuversetzen und die für diese Situation typischen Gefühle nachzuempfinden.
„Du-Perspektive“: Wo sie nicht funktioniert
Problematisch hingegen wird es in Geschichten, in denen der Leser tatsächlich als vollwertige Figur auftaucht. So habe ich als langjährige Fanfiction-Leserin und ‑Autorin nicht schlecht gestaunt, als ich mit Mitte 20 ein für mich zumindest komplett neues Fanfiction-Genre entdeckt habe: Sexy Figur X Reader – d. h. Fanfictions, in denen der meistens weibliche und heterosexuelle Leser mit einer meistens männlichen Figur eines Fandoms zusammenkommt. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten:
- Die Geschichte kann entweder ganz klassisch in der 3. Person erzählt werden, wobei der Name der Leserfigur durch einen Platzhalter ersetzt wird,
- oder die Leserfigur wird direkt mit „du“ bezeichnet.
Und ja, beide Alternativen wirken ziemlich skurril und ich zumindest konnte solchen Geschichten nie viel abgewinnen. Aber als Literaturwissenschaftlerin finde ich es dann doch irgendwie spannend. Zumindest die zweite Möglichkeit, denn die erste ist ja die gewohnte Erzählung in der 3. Person, nur dass die Hauptfigur keinen Namen hat.
Doch was die zweite Möglichkeit angeht, so ist das Problem etwas komplexer:
Der Leser ist ein einzigartiges Individuum, wird aber explizit aufgefordert, sich mit einer bestimmten Figur zu identifizieren, die anders aussieht als der Leser, anders denkt und anders fühlt und die der Leser auch erst kennenlernen muss.
Die Lektüre von Geschichten mit solchen Leserfiguren geht – bei mir zumindest – mit solchen befremdlichen Gedanken einher:
„Aha? So sehe ich also aus? Ganz und gar nicht wie ich. Und warum fälle ich diese und jene Entscheidung? Ich würde es ganz anders machen. Wer ist dieses ‚Du‘ überhaupt? Ich zumindest nicht.“
Natürlich haben solche Geschichten durchaus ihre Fans. Ich schließe auch nicht aus, dass man eine solche Geschichte schreiben kann, ohne dass sie solche befremdlichen Gedanken erzeugt. In dem Fall müsste die Leserfigur aber eine leere Leinwand ohne nennenswerte Persönlichkeit sein und dürfte auch keine gravierenden Entscheidungen fällen. Davon, dass keine Charakterentwicklung stattfinden dürfte, ganz zu schweigen. – Und solche Figuren sind tendenziell eher langweilig.
Metalepse und Interaktivität
Das Problem bei Leserfiguren ist, dass sie die vierte Wand aufzubrechen versuchen, ohne dass sie sie wirklich aufbrechen. Bzw. sie brechen nur eine Schicht auf, maximal zwei. Doch die dritte bleibt weiterhin intakt. Und weil diese dritte Schicht für diesen Erzählertyp die entscheidende ist, kann die Metalepse – zumindest in der beabsichtigten Form – nur misslingen.
Was ich damit meine?
Sprechen wir doch kurz über Kommunikationsebenen …
Kommunikationsebenen und die vierte Wand
In meiner Erzählanalyse von My Immortal von Tara Gilesbie habe ich es bereits erwähnt und für das zweite Halbjahr 2020 ist ein eigenständiger Artikel dazu geplant: das Modell der Kommunikationsebenen nach Wolf Schmid.
Laut diesem Modell ist die Kommunikation zwischen einem konkreten Autor und einem konkreten Leser mittels eines literarischen Werks wie eine Zwiebel aufgebaut:
- Auf der äußersten Ebene sind der konkrete Autor, der Mensch, der das literarische Werk geschrieben hat, und der konkrete Leser, der das literarische Werk gerade liest.
- Innerhalb des literarischen Werks findet man den abstrakten Autor, der Eindruck, den man vom Autor bekommt, wenn man das Werk liest, sowie die abstrakte Vorstellung vom Leser, die der Autor beim Schreiben hat, bzw. der ideale Leser, für den er das Werk schreibt.
- Die nächsttiefere Ebene ist die dargestellte Welt. Hier geht es endlich um Dinge, die tatsächlich konkret im Text stehen. Auf dieser Ebene bewegen sich der fiktive Erzähler, also die Figur, die aus irgendwelchen Gründen die Geschichte erzählt, und der fiktive Leser, also die Figur, diese Geschichte erzählt bekommt.
- Das, was der fiktive Erzähler erzählt, ist schließlich die erzählte Welt: die Ebene, auf der die Handlung stattfindet.
Diese ganzen Schichten des Erzählers und des Lesers sind nicht immer sichtbar, weswegen das Modell auf den ersten Blick vielleicht etwas verwirrend ist. Aber ich hoffe, Du kannst mir trotzdem folgen, wenn ich kurz erkläre, was passiert, wenn man eine Leserfigur in die Handlung einbringt:
Die Hauptfigur, die Teil der Handlung ist und mit den anderen fiktiven Figuren interagiert, befindet sich in der erzählten Welt. Der Autor versucht sich jedoch an einer Metalepse, einer Durchbrechung von Ebenen, indem er diese Hauptfigur zu einem Avatar für den konkreten Leser macht. Weil er all seine konkreten Leser aber nicht kennt und diese konkreten Leser auch sehr unterschiedlich sind, klappt nur ein Ebenenbruch hin zum fiktiven Leser, maximal zum abstrakten Leser – Entitäten, die der Autor kontrollieren kann.
Damit ein Bruch zum konkreten Leser möglich ist, damit dieser tatsächlich als Figur in der Handlung auftauchen kann, müsste er die Handlung mit seinen individuellen Entscheidungen beeinflussen können.
Und damit wären wir beim Thema:
Interaktives Erzählen
Das Rezipieren einer Geschichte ist grundsätzlich ein aktiver Prozess: Wenn wir ein Buch lesen oder einen Film schauen, dann denken wir mit, stellen in unserem Kopf Verbindungen her, vor unserem geistigen Auge arbeitet es und wir interpretieren und spekulieren. Noch aktiver ist der Rezipient, wenn er die Story aktiv beeinflusst und dadurch auch zum Mit-Erzähler seiner individuellen Version der Geschichte wird. Und wenn die Hauptfigur dabei auch noch ihn selbst repräsentiert, dann wird die Vereinigung von fiktiver Figur und konkretem Leser doch endlich möglich. … Oder?
Schauen wir uns doch mal ein paar verschiedene Ansätze an:
Spielbücher
Spielbücher sind eine semi-interaktive Erzählform, die dem klassischen Text noch am nächsten ist: Hier wird eine mit „du“ bezeichnete Figur in ein Abenteuer gestürzt und in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen wird der Leser vor die Wahl gestellt, was die Figur als Nächstes tun soll. Es werden mehrere vordefinierte Möglichkeiten angeboten und hinter jeder Möglichkeit steht eine Seitenzahl, wo die Geschichte mit der jeweiligen Entscheidung weitergeht.
Ein Bruch zum konkreten Leser findet jedoch nur bedingt statt, weil der Leser nur stellenweise Entscheidungen fällen kann und die vordefinierten Möglichkeiten nicht zwangsläufig die Entscheidung beinhalten, die der Leser am liebsten treffen würde. Außerdem kann die Leserfigur hier keine nennenswerte Persönlichkeit besitzen und auch dem Plot sind Grenzen gesetzt - und das macht eine Geschichte mit Tiefgang eher unwahrscheinlich.
Adventures, Visual Novels, Otome …
Durch Computertechnologie können solche Spielbücher aber deutlich komplexer werden: Das Ergebnis sind oft textlastige Videospiele, die aber in der Regel von Standbildern, minimalen Animationen und Sounds begleitet werden. Hier liest der Leser nicht einfach nur an einer bestimmten Stelle weiter, sondern seine Entscheidungen können beeinflussen, was die anderen Figuren von der Spielerfigur denken, der Spieler kann ein Inventar von eingekauften oder gefundenen Gegenständen haben, der die Handlung ebenfalls beeinflusst, und es kann auch Quick-Time-Events geben, bei denen der Spieler ein kleines Minispiel gewinnen muss. Es ist also gewissermaßen ein Roman, bei dem beispielsweise der Aufbau von Beziehungen simuliert werden kann, und das Hantieren mit Objekten und Quick-Time-Events fordern vom Leser sogar aktive Handlungen.
Diese Hybriden aus klassischem Roman und Videospiel können durchaus komplexe, ergreifende Geschichten erzählen, die durch die audiovisuelle Untermalung und die Interaktivität noch umso ergreifender sind. Die Protagonisten können dabei sowohl als vordefinierte Figuren als auch als Leserfiguren konzipiert sein. Bemerkenswert ist jedoch, dass das Erzählen oft nicht in der 2. Person stattfindet, sondern in der 1. Dass die Figur ein Stellvertreter für den Leser ist, merkt man oft nur daran, dass man am Anfang des Spiels den Standard-Namen der Hauptfigur in seinen eigenen ändern kann. Außerdem sind die Handlungsmöglichkeiten hier immer noch recht beschränkt und die Leserfiguren haben oft auch eine recht flache Persönlichkeit, um dem Spieler eine leere Projektionsfläche zu bieten. Tiefgang bekommt die Geschichte eher durch andere Figuren und die Interaktionen mit ihnen und der Umwelt.
Rollenspiele in Gruppen
Eine aktivere Rolle spielt der Rezipient bei Rollenspielen. Es gibt zwar einen vorgegebenen Rahmen, doch die Rezipienten schlüpfen in die Rollen der einzelnen Figuren und werden somit zu Co-Autoren einer ganz individuellen Handlung.
Was für eine Geschichte am Ende herauskommt, hängt sehr stark von den Spielern ab. Und damit eine solche Geschichte überhaupt zustande kommt, braucht man erstmal eine Gruppe von Gleichgesinnten, die mitspielen. Das Kommunikationsmodell mit einem konkreten Autor, Leser und literarischen Werk ist hier also gar nicht anwendbar.
Singleplayer-RPGs
Wo es anwendbar ist, sind Videospiele vom Typ Singleplayer-RPG. Hier schlüpft man entweder in die Rolle einer vordefinierten Figur oder man erschafft selbst eine, gerne auch nach eigenem Vorbild. Letzteres ist beispielsweise in der Elder-Scrolls-Reihe der Fall. – Und sofern man tatsächlich ein Abbild seiner Selbst erschafft und keine ausgedachte Figur, wird ein Bruch der vierten Wand durchaus möglich: Eine meiner Spielerfiguren in The Elder Scrolls V: Skyrim ist eine blonde, blauäugige Frau namens Katha mit einem Fetisch für schwere Rüstungen und möglichst große Waffen. Somit erzählt mir das Spiel, was wäre, wenn ich in der Welt von Skyrim landen würde. Dabei greifen vorgefertigte Storylines, meine eigenen Entscheidungen und auch pure Zufälle ineinander und generieren eine individuelle Geschichte:
Katha hat sich der Kriegergilde der Gefährten angeschlossen und sich in Farkas verliebt, wollte sich vor ihren Kameraden beweisen und Farkas beeindrucken, wurde im weiteren Verlauf zur Werwölfin, warf – überraschend für mich selbst – ihre moralischen Ideale über Bord und rottete in ihrer Werwolfsform einfach aus Spaß an der Freude ganze Banditenlager aus, fand jedoch ihre Moral wieder, nachdem ihr Mentor und später auch Farkas ihre Lykantropie aufgaben. Auch Katha ist mittlerweile wieder ein Mensch geworden, hat ein Haus gebaut, Farkas geheiratet und Kinder adoptiert. Sie führt also wieder ein ehrenhaftes Leben, abgesehen von der Sache mit ihrem besten Freund Marcurio: Sie hat ihn an ihrem Hochzeitstag kennengelernt und er hat ihr gleich einen Heiratsantrag gemacht. Doch obwohl sie ihn gefriendzoned hat, nimmt sie ihn auf all ihre Abenteuer mit, einfach weil sie ihn so gern mag und sie ein unschlagbares Team sind. Und sie genießt es heimlich, dass er immer noch versucht, sie ihrem Ehemann auszuspannen.
Ein richtiger Bruch der vierten Wand hin zum konkreten Rezipienten ist jedoch auch hier nicht möglich: Beispielsweise kann ich der Skyrim-Katha ohne Modifikationen am Spiel keine Größe von 153 cm geben und so ist die Dame im Vergleich zu mir einfach riesig. Und auch das Liebesdreieck mit Farkas und Marcurio ist in einer Sackgasse, denn in Skyrim gibt es keine Eifersuchtsmechanik: Farkas stört es wider aller Realismus-Logik nicht im Geringsten, dass seine Ehefrau mehr Zeit mit einem anderen Kerl verbringt als mit ihm, wobei der andere Kerl ihr zudem bereits einen Heiratsantrag gemacht hat und vor ihr unentwegt mit seinen Fähigkeiten prahlt. Marcurio wiederum ist grundsätzlich arrogant und selbstdarstellerisch und prahlt immer, wenn man ihn als Begleiter auswählt – egal, mit welcher Figur man spielt und was für eine Vorgeschichte man mit ihm hat. Dass er Katha zu beeindrucken versucht, ist einfach eine Interpretation, die durch den Kontext von Kathas individueller Geschichte entsteht. Es ist somit ein Zusammenspiel aus seinem festgelegten Standard-Verhalten, Zufällen im früheren Verlauf des Spiels sowie der Interpretationen, die in meinem Kopf entstehen. Somit kann die Skyrim-Katha noch so sehr mit den Gefühlen der beiden Herren spielen – Konsequenzen wird es nicht geben, denn sie wurden nie programmiert. Somit reagiert das Spiel nicht in jeder Hinsicht auf meine Entscheidungen und manche Handlungsstränge laufen ins Leere.
Videospiele ohne Handlung
Ein wirkliches Hereinholen des Rezipienten in die Geschichte ist eigentlich nur in Videospielen möglich, die überhaupt keine vorgefertigte Handlung besitzen: Minecraft beispielweise bietet dem Spieler nur eine Reihe von Spielmechaniken, mit denen der Spieler tun und lassen kann, was er will. Er kann die Spielwelt komplett umgestalten und im Rahmen der „Naturgesetze“ der Spielwelt seine einzigartigen Ideen umsetzen, die auch zu einem Ergebnis führen. Es entsteht somit eine individuelle Geschichte.
Diese Geschichte beinhaltet bis auf den Spieler jedoch keine Figuren mit einer nennenswerten Persönlichkeit. Spannende zwischenmenschliche Interaktionen sucht man hier also vergeblich und ob eine Geschichte mit anderweitigem Tiefgang entsteht, hängt sehr vom individuellen Spielverlauf auf. Denn Geschichten sind eben gar nicht der Sinn von Spielen wie Minecraft.
Fazit
Damit halten wir für das interaktive Erzählen also fest:
Es gibt viele Ansätze, um den Rezipienten zugleich „Leser“, Figur und sogar Co-Autor sein zu lassen, doch das geht in der Regel auf Kosten der erzählerischen Qualität.
Das interaktive Erzählen hat an sich sehr viel Potential und einige der ergreifendsten Geschichten wurden auf diese Weise erzählt. Diese Geschichten zeichnen sich jedoch durch eine Einschränkung der Gestaltungsmöglichkeiten durch den Rezipienten aus (zumindest, wenn man das interaktive Erzählen in Gruppen ausklammert). Am besten funktionieren selbst im interaktiven Genre Geschichten, in denen der Rezipient in die Rolle eines anderen schlüpft.
Ansonsten muss man auch anmerken, dass man selbst in Werken, in denen man die Hauptfigur selbst erstellt, nicht zwangsläufig ein Alter Ego erschafft. Im Gegenteil, solche Werke laden einen dazu ein, eine Fantasie zu erkunden.
Ja, ich habe in Skyrim eine Figur, die meinen Namen trägt und mir so ähnlich sieht, wie das Spiel es zulässt. Aber erstens kann ich mir nicht vorstellen, dass ich im realen Leben tatsächlich Menschen töten würde, schon gar nicht aus Spaß an der Freude, und ein Liebesdreieck würde mir emotionale Probleme bereiten und ich denke, ich würde es zu lösen versuchen, statt die Situation auszunutzen. Es gibt nun mal einen Unterschied zwischen realen Mitmenschen und fiktiven Computerfiguren ohne richtige Gefühle, mit denen man Experimente anstellen kann, die im realen Leben undenkbar wären. – U. a. auch, weil ihre Programmierung zu teilweise recht absurdem Verhalten führt und die Illusion, sie wären echte Menschen, dadurch schnell zerstört ist.
Zweitens ist meine wichtigste Spielfigur in Skyrim gar nicht Katha, sondern ein anthropomorpher Kater namens Dar’ajar: ein schleichender Feuer- und Illusionsmagier, Vampir und Mafiapate. Hier habe ich eine fiktive Figur erschaffen, mir eine Hintergrundgeschichte ausgedacht und spiele letztendlich nur eine Rolle, indem ich handle, wie Dar’ajar handeln würde.
Schlusswort
Was gibt es am Ende also zu sagen?
Wenn der Erzähler den Leser mit „du“ anspricht und ihn zum aktiven Protagonisten der Handlung zu machen versucht, funktioniert das nicht richtig und/oder geht auf Kosten der Tiefe.
Ich möchte nicht ausschließen, dass man mit einer hundertprozentigen Leserfigur eine gute Geschichte erzählen kann, doch es ist zumindest schwierig:
Denn je mehr Freiraum der Rezipient bei der Mitgestaltung der Handlung hat, desto weniger Freiraum hat der Autor. Und je mehr Freiraum der Autor für sich beansprucht, desto weniger repräsentiert die Rezipientenfigur den Rezipienten.
Der „Du-Erzähler“ funktioniert jedoch ganz gut, wenn man damit nicht direkt den konkreten Leser meint, sondern ihn durch das „Du“ nur dazu einlädt, sich in eine bestimmte Situation hineinzuversetzen. – In die Situation eines anderen.
Denn wie es scheint, sind Geschichten vor allem dazu da, dem Rezipienten Einblick in das Innenleben eines anderen zu bieten. Ihn jemand anders sein zu lassen. Nicht er selbst.


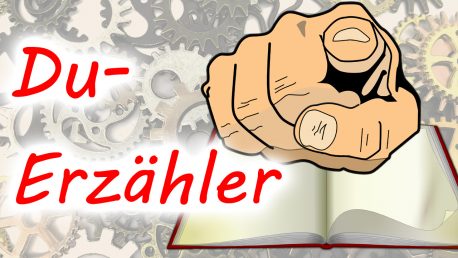
Hey, ich bewundere, wie ausführlich dieser Artikel ist. Teilweise kann ich nicht ganz so gut folgen, aber er ist ein wirklich guter Versuch, dieses komplexe Thema wirklich anschaulich herunter zu brechen. Vielen Dank!
Danke fürs Lob!
Wenn Du Fragen stellen möchtest, gerne her damit. 🙂
Also… der Artikel ist sehr ausführlich geschrieben jedoch empfinde ich es mit der Du-Form bei fanfics ganz anders. Wenn du ein Buch liest willst du dich doch in diese Welt fallen lassen? Warum ist es dann so schwer für einige sich damit zu identifizieren, wenn die Ich-Form genau dasselbe ist? Da fühen sich viele ja auch angesprochen und müssten denken „Sowas würde ich nie machen“ und darum geht es dabei auch gar nicht. Der Gedanke jemand anderes zu sein, darum geht es doch. Ich kenne Geschichten mit der Du-Form und es geht einfach viel tiefer, weil der Schreibstil so unglaublich schön ist. Es kommt also immer drauf an wie du schreibst und in den meisten fällen sind die Geschichten nur sehr halbherzig geschrieben. Leider. Keine Erklärung der Gefühle, keine großen Beschreibungen und ständig dieses: Ich ging… Ich setzte mich… Ich, ich, ich. Und da ist es dann auch völlig egal mit welcher Form man schreibt, weil einen schlechten Schreibstil kann man mit nichts retten
Ich glaube, ich verstehe Deinen Standpunkt und wenn der Du-Erzähler Dir gefällt, dann ist es doch schön. Ich für meinen Teil mag den Du-Erzähler gerade deswegen nicht, weil ich mich eben beim Lesen fallen lassen möchte. Der Unterschied zum Ich-Erzähler ist hier folgender:
● Beim Ich-Erzähler fühle ich mit einer anderen Person mit und versetze mich in ihre Situation und ihr Innenleben, ohne jedoch selbst diese Figur zu sein. Wenn diese Person also anders handelt, als ich es tun würde, habe ich kein Problem damit, solange es für diese andere Person logisch ist.
● Beim Du-Erzähler hingegen wird suggeriert, dass ich selbst gemeint bin. Wenn diese Figur in der Geschichte also auch nur einen Hauch von Persönlichkeit hat, wird diese Figur sich von mir unterscheiden. Mit dem „Du“ wird mir zwar gesagt, dass ich gemeint bin, aber gleichzeitig sehe ich, dass die Figur kaum etwas mit mir zu tun hat. Dadurch entsteht eine sogenannte kognitive Dissonanz, die mich aus dem Lesefluss reißt und mich somit daran hindert, mich fallen zu lassen.
Aber es stimmt eigentlich auch, dass es sehr stark darauf ankommt, wie eine Geschichte geschrieben ist. Eine gut geschriebene Geschichte mit einem Du-Erzähler würde ich einer schlecht geschriebenen Geschichte mit einem Ich-Erzähler jederzeit vorziehen.
Wenn ich einmal ein Buch schreiben würde, was nicht irgend n Handbuch zu irgend ner Software oder komischen CPU-Architektur ist, würde ich das wohl in der 2. Person schreiben… Einfach da ich nur Erfahrung im Erzählen in der 2. Person habe. Bin selber Dungeon Master, das ist die einzige Erfahrung, die ich mir Geschichten habe… Finde es persönlich auch schwierig sich in eine Person herein zu setzen, die nicht als du angesprochen ist… Könnte aber gut mein Asperger sein und der Fakt, dass ich halt auch DnD-Player bin -> meistens eben auch die 2. Person bei Erzählungen habe…
Manche Dinge – oder auch Erzählperspektiven – gehen einem wohl wirklich in Fleisch und Blut über. Aber wenn Du Dich mit dem Erzählen in der 2. Person wohler fühlst und es auch zu der Geschichte passt, dann ist ja alles gut. 🙂
Wenigstens wird nicht von Auto- und Homo oder Heterodiegese im fast unverständlichen Sinne von Gennet oder auch Stenzel geschrieben, sondern es werden sehr klar und verständlich jene Aspekte mitgeteilt, denen ich zustimme. Durch ein „DU“ fühle „ICH“ mich als Leser nicht angesprochen, einfach weil ich sicherlich anders bin als das, was der Autor/Autorin gemeint hat – und oft stimmt auch das DU-Geschlecht nicht, dann kommt es ganz eigenartig hinüber. Aber, wenn der Autor/AUtorin meint, so besser verstanden zu werden, seine/ihre Entscheidung – ich bin kein Fan davon.
Erzähltheorie oder auch „NARR-at-ologie“ – suum cuique, wie der „Franzose“ zu sagen pflegt
Och, Stanzel und Genette kann man durchaus verstehen, bloß sind theoretische Modelle eben ziemlich abstrakt und man muss schon der Typ für sowas sein. Ebenso wie auch der Du-Erzähler gewissermaßen eine Typsache zu sein scheint. Es gibt Leser, die lieben sowas. Aber das ist meistens ja auch eine sehr bestimmte Art von Geschichten.