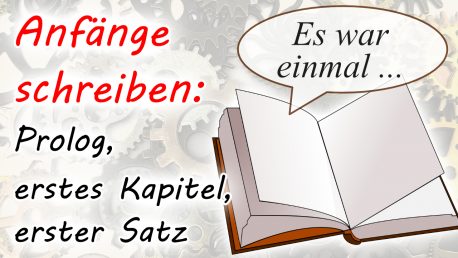Wo sollte man seine Erzählung beginnen? Am Anfang? Mittendrin? Mit einem Prolog? Was sind die Merkmale eines guten ersten Kapitels? Was macht einen guten ersten Satz aus? – Der Anfang entscheidet oft, ob auch der Rest der Geschichte gelesen wird. Deswegen befassen wir uns in diesem Artikel mit genau diesen Fragen.
Die Folien für dieses Video gibt es für Steady-Abonnenten und Kanalmitglieder auf YouTube als PDF zum Download.
Es gibt keine zweite Chance für einen ersten Eindruck. Deswegen gehört der Anfang einer Geschichte beim Schreiben zu den wichtigsten Dingen überhaupt. Nehmen wir uns also dieses Themas an und sprechen in diesem Artikel allgemein über Anfänge, den Sinn und Unsinn von Prologen sowie über den ersten Satz.
Anfänge schreiben: Verführen, informieren, neugierig machen
Der Zweck eines guten Anfangs ist denkbar simpel:
Er soll den Interessenten dazu bewegen, auch den Rest der Geschichte zu lesen.
Wie das geht, haben wir etwas oberflächlich bereits in einem früheren Artikel besprochen: Da haben wir die AIDA-Formel aus dem Marketing unter anderem auf den Anfang angewandt.
AIDA setzt sich dabei zusammen aus:
- A → Attention → Aufmerksamkeit erregen
- I → Interest → Interesse wecken
- D → Desire → Begehren auslösen
- A → Action → zum Handeln auffordern
Konkret auf Geschichtenanfänge bezogen bedeutet das:
Der Anfang einer Geschichte bzw. einer Erzählung bzw. eines Buches (was auch immer) muss etwas Besonderes sein, sich abheben und den Leser aus seinem Alltagstrott reißen. Er sollte vermitteln, was die Geschichte zu bieten hat, und die Bedürfnisse der Zielgruppe ansprechen. Und nicht zuletzt sollte er neugierig machen, Fragen aufwerfen und in den Konflikt einführen, sodass der Leser unbedingt erfahren will, wie es weitergeht. Idealerweise folgt daraufhin die Handlung des Lesers, nämlich dass er an der Geschichte kleben bleibt.
Mit anderen Worten:
Wenn Deine Geschichte mit dem Klingeln des Weckers anfängt, mit dem Zähneputzen weitergeht und der Protagonist anschließend in den Spiegel schaut und dabei beschrieben wird, dann ist das eine Klischee-Parade, die Dich als Schreibanfänger outet: Gefühlt die Hälfte der Geschichten von unerfahrenen Autoren beginnt genau so. – Laaangweilig!
Dos und Don’ts
Es geht in vielerlei Hinsicht aber auch darum, eine gesunde Balance zu halten:
- So ist es zwar wichtig, Fragen aufzuwerfen, doch wenn es in der ersten Szene um Holomisuhasitams vom Planeten Furzevick geht, die über Tölöweradetas diskutieren und sich Gerazimonare als Ziel setzen, dann versteht der Leser nur Bahnhof: Er braucht klare Informationen, an denen er sich festhalten kann, um dem Geschehen einigermaßen zu folgen, eine Verbindung zu den Figuren aufzubauen und sich irgendwie um den weiteren Verlauf der Geschichte zu scheren.
- Und damit wären wir auch schon bei der Einführung in die Welt und evtl. auch bei der Vorstellung der wichtigsten Figuren. Um der Handlung folgen zu können, braucht der Leser zumindest grobe Antworten auf die Fragen: Wer? Was? Wo? Wann? – Was im Übrigen oft auch mit dem Aufbauen von Atmosphäre einhergeht. Falsch wäre allerdings, dem Leser alles haarklein zu erklären, ihn nicht mitdenken zu lassen, die Informationen also fast enzyklopädisch in einem fetten, langweiligen Info-Dump abzuladen.
- Auch sollte der Anfang idealerweise so gewählt werden, dass er mit der Prämisse oder zumindest mit den zentralen Themen etwas zu tun hat. Er fungiert nun mal automatisch als Versprechen und sollte deswegen zum Rest der Geschichte passen. Wenn der Anfang einer Liebesgeschichte also einen Krimi verspricht, dann brauchst Du Dich nicht zu wundern, wenn Du Krimi-Fans anlockst und diese dann enttäuscht sind, während Liebesgeschichten-Fans Dein Werk gar nicht erst anfassen.
- Nicht zuletzt sollte der Anfang natürlich interessant sein – und das schreit nach einem Konflikt. Das bedeutet nicht, dass da sofort die Fetzen fliegen müssen, aber es sollte nicht zu lange dauern, bis Spannung entsteht. Denn wenn da seitenweise nichts passiert als Friede, Freude, Eierkuchen, dann hat der Leser irgendwann keinen Grund zu glauben, dass in der Geschichte noch etwas Interessantes passiert.
Am wichtigsten ist aber der sog. „Hook“: der „Haken“, mit dem man den Leser am Text festhält. Denn den Leser festzuhalten ist ja der Sinn und Zweck eines Anfangs. Dabei kann der „Hook“ selbst alles Mögliche oder sogar eine Kombination von allem Möglichen sein: Von einer interessanten Welt, einer packenden Atmosphäre über spannende Figuren und Situationen bis hin zur Perspektive und Sprache des Erzählers kann es alles sein, was die Geschichte eben irgendwie abhebt und einen Grund zum Weiterlesen liefert.
Und natürlich sollte dieser „Hook“ – oder der erste von mehreren „Hooks“ – möglichst früh auftreten:
Denn je länger es dauert, bis der Leser „gehooked“ ist, desto wahrscheinlicher ist, dass er abspringt.
Ab ovo vs. in medias res
Doch genug von den Anforderungen an gute Anfänge. Uns interessiert nämlich auch die Frage, an welcher Stelle man überhaupt eine Erzählung anfängt. Denn wie in einem früheren Artikel bereits erläutert, unterscheidet man aus gutem Grund zwischen Story und Plot:
- Story: was passiert ist
- Plot: die Art und Weise, wie davon erzählt wird
Während in einer Story alles säuberlich chronologisch verläuft, kann der Plot im Prinzip an jeder beliebigen Stelle beginnen. Wenn man das Ganze aber auf die zwei grundlegendsten Varianten herunterbricht, landet man schnell bei den vom römischen Dichter Horaz geprägten Wendungen ab ovo und in medias res:
- Eine Erzählung ab ovo beginnt dort, wo auch die Story anfängt.
- Ein Beginn in medias res (alternativ auch medias in res) ist mitten in der Story angesiedelt, die Handlung ist also sofort in vollem Gange.
Zum Beispiel beginnt Stolz und Vorurteil von Jane Austen ab ovo, nämlich als der reiche Single Mr. Bingley in der Nachbarschaft der Familie Bennet einzieht. In medias res wäre gegeben, wenn der Roman damit anfangen würde, dass Elizabeth Bennet sich über Bingleys Freund Darcy ärgert.
Umgekehrt beginnt Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque in medias res, nämlich kurz nachdem Paul Bäumer und seine Kameraden an der Front abgelöst wurden. Erst später wird berichtet, wie sie motiviert wurden, sich freiwillig zum Kriegsdienst zu melden, und wie ihre Ausbildung zu Soldaten verlief. Ab ovo wäre gewesen, wenn der Roman im Klassenzimmer begonnen hätte, als die damaligen Schuljungen der Gehirnwäsche durch ihren Lehrer ausgesetzt waren.
Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass das, was man als Anfang einer Story betrachtet, stets davon abhängt, wo man die Schwerpunkte setzt:
Denn dreht sich alles um das Verheiraten der Bennet-Töchter, beginnt die Story mit dem Auftauchen geeigneter Heiratskandidaten. Setzt man jedoch den Schwerpunkt auf die miserable finanzielle Lage der Bennets, müsste man beschreiben, wie sie sich entwickelt, als Mr. und Mrs. Bennet fünf Töchter, aber keine Söhne bekommen.
Außerdem sollten der Vollständigkeit halber auch in ultimas res, in nuce und die Invocatio genannt werden. Diese Begriffe bezeichnen eine Erzählung, die mit dem Ende beginnt, einen Anfang, der Anspielungen auf den späteren Verlauf enthält, und den Beginn mit einer Anrufung, einer Begründung für den Erzählakt oder anderweitigem Vorgeplänkel. Ich persönlich halte sie jedoch weniger für eigenständige Typen, sondern eher für eine spezielle Form des anachronistischen Anfangs, also in medias res, bzw. für eine stilistische Entscheidung. Deswegen beschränke ich mich lieber auf ab ovo und in medias res, d. h. auf die Entscheidung zwischen einem chronologischen Anfang und einem anachronistischen.
Einen geeigneten Anfang finden
Doch welcher Ansatz eignet sich für konkret Deine Geschichte? Das kannst natürlich nur Du selbst wissen, denn nur Du weißt, welche möglichen Startpunkte es in der Story überhaupt gibt. Dennoch solltest Du einige Dinge bedenken, wenn Du den Punkt auswählst, an dem der Plot beginnen soll:
- Grundsätzlich sollte es ein Moment sein, der die bereits genannten Qualitätskriterien für einen guten Anfang am ehesten erfüllt. Und wenn ein solcher Moment noch nicht existiert, dann schau Dir die Qualitätskriterien noch einmal an und nutze sie als Grundlage, um einen solchen Moment zu erschaffen. Fokussiere Dich dabei vor allem auf Deine Prämisse, denn nur wenn Du weißt, worum es in Deiner Geschichte geht, kannst Du auch beurteilen, welcher Moment ein geeigneter Anfang wäre.
- Achte besonders darauf, dass die Handlung möglichst bald losgeht. Soll heißen: Ein guter Anfang ist der Moment, ab dem es interessant wird, bzw. kurz davor.
- Manche Geschichten sind jedoch mit einem langsamen Anfang besser bedient, zum Beispiel wenn komplexes World-Building erforderlich ist, weil der Leser sonst den Rest der Geschichte nicht versteht. In diesem Fall solltest Du darauf achten, dass der noch so schleppende Anfang immer noch die Qualitätskriterien erfüllt, sei es durch packende Figuren, spannende Konflikte oder was auch immer. Notfalls kann es auch helfen, der eigentlichen Handlung einen Prolog voranzustellen, in dem die spannenden Dinge, die in der Geschichte noch passieren, schon mal angedeutet werden. Dazu aber gleich noch ausführlicher.
- Generell solltest Du Dir während des Schreibens aber nicht allzu sehr einen Kopf machen. Zunächst ist es einfach nur wichtig, dass Du irgendwie anfängst und Deinen Erstentwurf beendest. Später, beim Überarbeiten, kannst Du die Szenen immer noch verschieben oder komplett neue Passagen schreiben. Und weil Du zu dem Zeitpunkt schon die ganze Geschichte niedergeschrieben haben wirst, solltest Du auch eine bessere Ahnung haben, welcher Anfang am besten passt.
Prologe
Nun ist aber bereits das Stichwort „Prolog“ gefallen und wir wollen auch direkt darauf eingehen: Wann ist ein Prolog sinnvoll und wann sollte die Geschichte ganz normal mit dem ersten Kapitel anfangen?
Klären wir zu nächst die Frage, was ein Prolog überhaupt ist:
Wörtlich übersetzt aus dem Griechischen bedeutet es „Vorwort“ – aber meistens meint man damit eine ganz bestimmte Art von Vorwort, nämlich ein Kapitel vor dem ersten Kapitel, das dem Leser vermittelt, was er vor der Lektüre der eigentlichen Geschichte wissen sollte.
Solche „Vorworte“ sind feste Bestandteile ihrer jeweiligen Geschichten und sollen neugierig machen. Nichtsdestotrotz heben sie sich oft vom Rest der Geschichte ab: Nicht nur durch die Überschrift „Prolog“ statt „Kapitel 1“, sondern weil sie beispielsweise aus einer anderen Perspektive erzählen, in einer anderen Zeit spielen oder eine Legende oder Prophezeiung wiedergeben, die in der eigentlichen Geschichte relevant wird.
Vorsicht: Ist ein Prolog wirklich notwendig?
Doch so nett Prologe auch klingen mögen, schwingt hier oft die Gefahr von Kitsch und Klischee mit. Besonders Flashbacks, Legenden und Prophezeiungen werden inflationär benutzt, obwohl sie für die konkrete Geschichte gar nicht notwendig sind.
Ein cringiges Beispiel findet sich im deutschen Blockbuster Der Rote Baron, dessen erste Szene den Protagonisten Manfred von Richthofen als Kind zeigt, wie er ein Flugzeug sieht, auf seinem Pferd hinterherreitet und die Arme ausbreitet, als würde er fliegen. Offenbar ist es sein Kindheitstraum, Pilot zu werden. – Doch das spielt im weiteren Verlauf des Films keine Rolle – und dass Richthofen gerne fliegt und seine Kampfeinsätze im Ersten Weltkrieg als eine Art Sport ansieht, kommt in vielen anderen Szenen der eigentlichen Geschichte eindeutig rüber. Der „Prolog“ mit Richthofens Kindheit ist also eine völlig überflüssige und dazu auch noch superkitschige Szene.
Ich sage nicht, dass Flashbacks und geheimnisvoller mystischer Krimskrams keine guten Prologe hergeben können, aber abgesehen davon, dass sie viel zu häufig verwendet werden, solltest Du generell überprüfen, ob Deine Geschichte überhaupt einen Prolog braucht:
Wenn er gestrichen werden kann, ohne dass die Geschichte etwas verliert, dann sollte er eben gestrichen werden.
Ein strukturelles Argument für einen Prolog wurde bereits erwähnt, nämlich dass er sinnvoll sein kann, wenn die eigentliche Geschichte – aus welchen Gründen auch immer – nur langsam ins Rollen kommt und der Leser schon mal einen Vorgeschmack bekommen soll, was ihn später erwartet. Zum Beispiel könnte ein Prolog, in dem blutige Fetzten fliegen, im Zusammenspiel mit einem idyllischen ersten Kapitel Spannung erzeugen, weil man da durch den blutigen Prolog ja im Hinterkopf hat, dass die Idylle bald ein Ende nimmt.
Außerdem könnte ein Prolog auch eine alternative Perspektive auf die eigentliche Geschichte liefern, sodass man das Geschehen der eigentlichen Geschichte zwar durch die Augen des Protagonisten beobachtet, aber gleichzeitig weiß, dass man die Dinge auch anders sehen könnte. Auch können Prologe schon mal ein wenig World-Building leisten, wenn es für das Verständnis des ersten Kapitels notwendig ist.
Ein Beispiel für einen guten Prolog findet sich in Das Lied von Eis und Feuer von George R. R. Martin: Während die anderen Kapitel wiederkehrende Reflektorfiguren haben, fungiert der Nachtwächter Will nur hier als Reflektor. Durch seine Augen bekommt der Leser bereits einen ersten Einblick in die Welt, in der die Buchreihe spielt, und sieht die Anderen, die Weißen Wanderer, deren Existenz in der eigentlichen Geschichte systematisch angezweifelt wird. Und da der Leser ja weiß, dass sie wirklich existieren und eine Bedrohung darstellen, trägt das in den späteren Kapiteln zur Spannung bei.
Übrigens muss ein Prolog auch nicht unbedingt „Prolog“ als Überschrift haben:
So gibt es in der Harry Potter-Reihe manchmal De-facto-Prologe, strenggenommen erste Kapitel, die aber eine andere Reflektorfigur haben als Harry und dem Leser Informationen vermitteln, die später relevant werden, von denen Harry aber noch nichts weiß.
Interessant sind auch Dinge wie „Eingang“ und „Ausgang“ in Remarques Der Weg zurück, die faktisch den Prolog und den Epilog darstellen und eine Art Rahmen für den titelgebenden Weg zurück ins zivile Leben bilden: Der „Eingang“ zeigt das Ende des Ersten Weltkriegs, der „Ausgang“ zeigt, wie die überlebenden Figuren sich mit dem zivilen Leben arrangiert haben, und alles dazwischen zeigt ihre Schwierigkeiten nach ihrer Rückkehr von der Front.
Einen Prolog schreiben
Bevor Du also einen Prolog einbaust, solltest Du genau überlegen, welche Funktion er für die Geschichte erfüllt. Die Möglichkeiten sind hierbei grenzenlos: von einem Vorwort, in dem ein angeblicher Herausgeber behauptet, die Ereignisse in der Geschichte wären real, bis hin zu Prologen, die faktisch ganz reguläre Kapitel sind, ist alles erlaubt.
Was für Deine Geschichte das Richtige ist, hängt aber von Deinem individuellen Werk ab. Wichtig ist nur, dass der Prolog, sofern Du ihn einbaust, relevant ist und die Geschichte bereichert und außerdem natürlich auch die Qualitätskriterien für einen guten Anfang erfüllt. Und wenn Deine Geschichte wunderbar ohne Prolog auskommt oder Dir kein Prolog einfällt, dann lass ihn weg: Das wäre eine potentielle Klischeefalle weniger.
Der erste Satz
Aber egal, ob Dein Werk mit einem Prolog oder direkt mit dem ersten Kapitel beginnt: Den Anfang einer jeden Geschichte bildet der erste Satz. Und weil es, wie gesagt, keine zweite Chance für einen ersten Eindruck gibt, muss er möglichst perfekt sein. Denn von ihm hängt sehr stark ab, ob auch der zweite Satz und schließlich der Rest der Geschichte gelesen wird.
Wie schreibt man also einen guten ersten Satz?
Arten von ersten Sätzen
In seinem Buch ‚Jemand musste Josef K. verleumdet haben …‘: Erste Sätze der Weltliteratur und was sie uns verraten zerlegt Peter-André Alt, wie der Titel schon sagt, erste Sätze aus der Weltliteratur und ordnet sie in verschiedene Kategorien ein. Diese wären:
- eine Anrufung der Götter, damit sie dem Dichter während des Schöpfungsprozesses beistehen, wie sie in der Antike üblich war,
„Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes, | Welcher so weit geirrt, nach der heiligen Troja Zerstörung, | Vieler Menschen Städte gesehn, und Sitte gelernt hat, | Und auf dem Meere so viel‘ unnennbare Leiden erduldet, | Seine Seele zu retten, und seiner Freunde Zurückkunft.“
Homer: Odyssee, Übersetzung von Johann Heinrich Voß, 1. Gesang.
- ein Vorwort eines angeblichen Herausgebers, der behauptet, bei dem Text würde es sich um reale Aufzeichnungen handeln, was besonders für die frühe Neuzeit charakteristisch ist,
„Lemuel Gulliver, der Verfasser dieser Reisen, ist mein alter, intimer Freund, auch verwandtschaftliche Beziehungen bestehen zwischen uns von mütterlicher Seite.“
Jonathan Swift: Gullivers Reisen zu mehreren Völkern der Welt, Übersetzung von Franz Kottenkamp, Der Herausgeber an den Leser.
- eine Behauptung, durch die der Erzähler Autorität und Weltkenntnis ausstrahlt,
„Es ist eine Wahrheit, über die sich alle Welt einig ist, daß ein unbeweibter Mann von einigem Vermögen unbedingt auf der Suche nach einer Lebensgefährtin sein muß.“
Jane Austen: Stolz und Vorurteil, Übersetzung von Karin von Schwab, 1. Kapitel.
- die Beschreibung einer Figur,
„An einem Orte der Mancha, an dessen Namen ich mich nicht erinnern will, lebte vor nicht langer Zeit ein Junker, einer von jenen, die einen Speer im Lanzengestell, eine alte Tartsche, einen hagern Gaul und einen Windhund zum Jagen haben.“
Miguel de Cervantes Saavedra: Der sinnreiche Junker Don Quijote von der Mancha, Übersetzung von Ludwig Braunfels, 1. Buch, 1. Kapitel.
- Angaben zu Ort und Zeit,
„In einer Stadt, die ich aus mancherlei Gründen weder nennen will, noch mit einem erdichteten Namen bezeichnen möchte, befand sich unter anderen öffentlichen Gebäuden auch eines, dessen sich die meisten Städte rühmen können, nämlich ein Armenhaus.“
Charles Dickens: Oliver Twist, Übersetzung von von Carl Kolb, 1. Kapitel.
- die Beschreibung einer Situation,
„Alice fing an sich zu langweilen; sie saß schon lange bei ihrer Schwester am Ufer und hatte nichts zu tun.“
Lewis Carroll: Alice im Wunderland, Übersetzung von Antonie Zimmermann, 1. Hinunter in den Kaninchenbau.
- ein plötzliches Ereignis,
„In M…, einer bedeutenden Stadt im oberen Italien, ließ die verwitwete Marquise von O…, eine Dame von vortrefflichem Ruf, und Mutter von mehreren wohlerzogenen Kindern, durch die Zeitungen bekannt machen: daß sie, ohne ihr Wissen, in andre Umstände gekommen sei, daß der Vater zu dem Kinde, das sie gebären würde, sich melden solle; und daß sie, aus Familienrücksichten, entschlossen wäre, ihn zu heiraten.“
Heinrich von Kleist: Die Marquise von O…
- Spannungsaufbau,
„Im Frühling des Jahres 1894 war das gesamte London neugierig und die Oberschicht in der ganzen Welt bestürzt über den Mord am ehrenwerten Ronald Adair, der unter den ungewöhnlichsten und rätselhaftesten Umständen zu Tode kam.“
Arthur Conan Doyle: Das leere Haus, Übersetzung von Alexander Wlk.
- Stimmungsaufbau,
„Es war ein schöner Sommerabend, als Florio, ein junger Edelmann, langsam auf die Tore von Lucca zuritt, sich erfreuend an dem feinen Dufte, der über der wunderschönen Landschaft und den Türmen und Dächern der Stadt vor ihm zitterte, sowie an den bunten Zügen zierlicher Damen und Herren, welche sich zu beiden Seiten der Straße unter den hohen Kastanienalleen fröhlich schwärmend ergingen.“
Josef von Eichendorff: Das Marmorbild.
- Sprechakte,
„Lolita, Licht meines Lebens, Feuer meiner Lenden.“
Vladimir Nabokov: Lolita, Übersetzung von Helen Hessel, Maria Carlsson, Kurt Kusenberg, Heinrich Maria Ledig-Rowohlt, Gregor von Rezzori, Dieter E. Zimmer, 1. Teil, 1.
- Unwahrscheinliches,
„Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt.“
Franz Kafka: Die Verwandlung.
- Kitsch und Triviales,
„Im Schatten des Hauses, in der Sonne des Flußufers bei den Booten, im Schatten des Salwaldes, im Schatten des Feigenbaumes wuchs Siddhartha auf, der schöne Sohn des Brahmanen, der junge Falke, zusammen mit Govinda, seinem Freunde, dem Brahmanensohn.“
Hermann Hesse: Siddhartha. Eine indische Dichtung, 1. Teil, Der Sohn des Brahmanen.
- Ironie,
„An dem Morgen, als die letzte Lisbon-Tochter Selbstmord beging – Mary diesmal, mit Schlaftabletten wie Therese –, wussten die Sanitäter schon genau, wo die Schublade mit den Messern war, wo der Gasherd und wo im Keller der Balken, an dem man das Seil festbinden konnte.“
Jeffrey Eugenides: Die Selbstmord-Schwestern, Übersetzung von Mechtild Sandberg-Ciletti, Eike Schönfeld, 1.
- ein Spiel mit Anfang und Ende.
„Die Ewige Wiederkehr ist ein geheimnisvoller Gedanke, und Nietzsche hat damit manchen Philosophen in Verlegenheit gebracht: alles wird sich irgendwann so wiederholen, wie man es schon einmal erlebt hat, und auch diese Wiederholung wird sich unendlich wiederholen!“
Milan Kundera: Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, Übersetzung von Susanna Roth, Erster Teil: Das Leichte und das Schwere, I.
Sicherlich können wir uns darauf einigen, dass viele erste Sätze wohl in mehrere Kategorien passen. Und ebenso müssten wir uns darauf einigen können, dass die ersten Sätze oft von den Konventionen ihrer jeweiligen Zeit beeinflusst werden. Welche Art von ersten Sätzen ist also für den heutigen Leser geeignet, der sich in einem übersättigten Markt bewegt und bekanntermaßen die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfischs hat?
Der Bestseller-Code
In einer früheren Reihe habe ich bereits das Buch Der Bestsellder-Code von Jodie Archer und Matthew L. Jockers zusammengefasst, die ca. 5000 Bestseller und Nicht-Bestseller durch einen Algorithmus gejagt haben, um herauszufinden, was die Gemeinsamkeiten von verkaufsstarken Büchern sind. Auch über erste Sätze gab es Erkenntnisse und ich habe sie in Teil 3 zusammengefasst. Hier aber zur Auffrischung noch einmal:
- Der ideale erste Satz ist kurz, einfach und klar strukturiert.
- Er wirkt authentisch, der Erzähler strahlt durch seine Gewissheit Autorität aus, aber auch Witz macht sich gut, wenn es darum geht, die Aussage scheinbar mühelos auf den Punkt zu bringen.
- Und nicht zuletzt enthält der erste Satz gerne den gesamten Konflikt des Romans und verspricht Handlung.
Oder noch kürzer zusammengefasst:
Der erste Satz ist leicht und angenehm zu lesen, sendet eine klare Botschaft und gibt einen Vorgeschmack auf das ganze Werk.
Tipps für den ersten Satz
Wie Du Dir aber sicherlich bereits denken kannst, sind gelungene erste Sätze so individuell wie die Werke, zu denen sie gehören, und ich bezweifle, dass es ein Patentrezept dafür geben kann. Aber hier trotzdem ein paar Tipps:
- Du wirst wahrscheinlich nicht beim ersten Anlauf den perfekten ersten Satz formulieren. Versuche es also gar nicht erst.
- Überlege eher, womit Du generell anfangen willst, ab ovo oder in medias res, mit einer Szene, einem Schauplatz, einer Figur, einer Behauptung oder womit auch immer, lasse Dich von Alts Typologie inspirieren und achte auf die AIDA-Formel.
- Der perfekte erste Satz oder zumindest Ideen dafür kommen oft erst mit der Zeit im Laufe des Schreibens. Auch wirst Du den Anfang womöglich ohnehin mehrmals überarbeiten und Szenen und Absätze umstellen. Deswegen muss der erste Satz erst am Ende des Schreib- bzw. sogar Überarbeitungsprozesses wirklich feststehen.
- Und wenn Du Dich zwischen mehreren Ideen nicht entscheiden kannst oder einfach wissen willst, ob Deine Idee etwas taugt, kannst Du Deinen ersten Satz bzw. Deine Ideen ja anderen Leuten vortragen und sie fragen, ob das nach einem interessanten Buch klingt.
Schlusswort
So viel zu Anfängen von Geschichten. – Wie Du siehst, ein wichtiges Thema, bei dem es sehr viel zu beachten gibt. Ein misslungener Anfang bedeutet zwar nicht automatisch, dass Deine Geschichte nicht gelesen wird: Denn auch Titel, Cover, Klappentext und gute Kritiken haben einen Einfluss darauf, ob Deine Geschichte Interesse weckt. Aber der Anfang ist dennoch ein wesentlicher Faktor, der über den Erfolg Deines Buches entscheidet. Wähle ihn also weise.
Ansonsten schreit vor allem das Thema der ersten Sätze nach besonders vielen Beispielen, die aber nicht in ausreichendem Maße in diesem einen Theorie-Artikel behandelt werden können. Deswegen möchte ich am 22.08.2021 gerne in einem exklusiven Livestream für Steady-Mitglieder mehr auf die Praxis eingehen und über eine Auswahl konkreter erster Sätze reden, gerne auch über Einsendungen aus der Community, seien es erste Sätze aus Lieblingsbüchern oder eigenen Werken. Über Deine Teilnahme und gleichzeitige finanzielle Unterstützung würde ich mich sehr freuen!