Heutzutage wollen alle Geschichten über starke Frauen erzählen. Von friedlicher Emanzipation bis hin zum Action Girl ist alles vertreten. Und doch verkommen auch diese neuen Heldinnen schnell zu abgedroschenen Klischees. Wie erschafft man also interessante (!) starke Frauen? Und was ist eine „starke Frau“ überhaupt? Hier einige grundlegende Überlegungen …
Die Folien für dieses Video gibt es für Steady-Abonnenten und Kanalmitglieder auf YouTube als PDF zum Download.
Vorsicht, heute wird es explosiv! Denn wann immer man heutzutage über Geschlechterunterschiede, Geschlechterrollen und deren Darstellung in den Medien spricht, entsteht viel Geschrei, viel Zoff und es hagelt Dislikes. – Dabei ist es egal, was man sagt, für welche „Seite“ man sich ausspricht oder ob man neutral bleibt.
Doch gleichzeitig zeigt diese sensible Reaktion vieler Menschen, wie wichtig solche Themen sind. Wir haben bereits über Mary Sues gesprochen sowie nach neuen Helden für Jungen und Männer gesucht.
Nun ist es aber an der Zeit, das Thema in seinen Grundfesten anzupacken. Zumindest die weibliche Hälfte davon:
Moderne Geschichten sind voll von Versuchen, starke Frauenfiguren zu erschaffen.
Aber was macht eine starke Frau überhaupt aus?
Und wie verhindert man, dass die starken Frauen in der eigenen Geschichte zu platten Klischees verkommen?
Diesen äußerst wichtigen Fragen gehen wir heute nach.
Was ist eine „starke Frau“?
„Starke Frau“ setzt sich zusammen aus: „stark“ und „Frau“. Holen wir also tatsächlich so weit aus und definieren als erstes die Begriffe „Stärke“ und „Frau“.
Was ist „Stärke“?
Ich denke, wir sind uns alle einig, was körperliche Stärke bedeutet:
- Wenn man mehr körperliche Kraft besitzt als der Durchschnitt.
Sie äußert sich zum Beispiel darin, dass man schwere Gegenstände heben oder hart zuschlagen kann.
- Manchmal reden wir aber auch von Stärke, wenn das Fehlen einer besonderen körperlichen Kraft durch andere Mittel kompensiert wird:
Zum Beispiel durch Schusswaffen, magische Fähigkeiten, virtuose Kampftechnik oder politische und/oder gesellschaftliche Macht.
Doch ich denke, wir sind uns auch alle einig, dass es auch noch andere Arten von Stärke gibt:
- Nämlich die geistige, charakterliche, innere Stärke.
Und was das ist, variiert tatsächlich von Kultur zu Kultur, von Epoche zu Epoche und von Mensch zu Mensch. Ein Beispiel:
Bei uns im Westen wird es begrüßt, wenn jemand, der ein anderes Leben führen will als seine Familie für richtig hält, sich aktiv wehrt. Das liegt unter anderem daran, dass die westeuropäische und US-amerikanische Mentalität sehr individualistisch ist. Die Interessen und die Freiheit des Individuums stehen über den Interessen der Allgemeinheit. Eine starke Persönlichkeit weiß, was sie will, und setzt sich durch.
In fernöstlichen Kulturen hingegen ist es genau umgekehrt: Die Interessen des Individuums sind den Interessen der Allgemeinheit oder zumindest der Familie untergeordnet. Folglich gilt jemand, der zum Beispiel durch das Ausleben seiner individuellen Interessen die Gefühle seiner Familie verletzt, als infantiler Egoist. Eine starke Persönlichkeit stellt ihre persönlichen Interessen hintenan, dient dem Allgemeinwohl und respektiert die älteren Familienmitglieder.
(Hier ein höchst interessanter Artikel zu dem Thema: T. K. Marnell: American vs. East Asian Storytelling.)
Was ist „innere Stärke“ also? Das Überwinden widriger Umstände, um ein authentischeres Leben zu führen? Oder Rücksicht auf die Gefühle anderer, Demut und Vergebung?
Oder beides?
Innere Stärke und das Individuum
Schauen wir uns mal ein anderes Beispiel an:
Fritzchen und Lieschen und Max und Erika sind Paare. Fritzchen und Erika gehen miteinander fremd. Lieschen ist eine kleinlaute Maus, die von Fritzchen alles hinnimmt und sich an ihn klammert. Wenn sie sich also von ihm trennt, zeigt sie Stärke. Max hingegen lässt nichts auf sich sitzen und schlägt immer zurück. Wenn er Erika aus Liebe verzeiht und einsieht, dass auch er nicht fehlerlos ist, zeigt er Stärke.
Lieschen und Max sind unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Problemen, obwohl sie sich in einer ähnlichen Situation befinden. Deswegen bedeutet Stärke für jeden von ihnen etwas anderes. Aber in beiden Fällen wird über den eigenen Schatten gesprungen.
Und wenn es eine allgemeingültige Definition von „innerer Stärke“ überhaupt geben kann, dann, denke ich, haben wir sie gerade eben formuliert:
Innere Stärke ist die Kraft, über den eigenen Schatten zu springen.
Seine Ängste zu überwinden, seinen Stolz …
Innere Stärke braucht somit vor allem eine Schwäche.
Und letztendlich ist das die Eigenschaft, die in den „großen Geschichten“ wohl am meisten besungen wird. Oder wie Samweis Gamdschie es am Ende von Die zwei Türme formuliert, als Frodo kurz vorm Aufgeben ist:
„Die Leute in diesen Geschichten hatten stets die Gelegenheit umzukehren, nur taten sie es nicht. Sie gingen weiter. Weil sie an irgendetwas geglaubt haben.“
Was auch immer die Werte deiner Figur also sind:
Wenn sie nach ihren Werten lebt (welcher Natur diese auch sein mögen) und dazu ihre Schattenseiten überwindet (weitergeht, obwohl Umkehren einfacher wäre), dann ist das eine starke Persönlichkeit.
Und ich wage außerdem zu behaupten:
Eine starke Persönlichkeit ist das, was eine Figur wirklich interessant macht. Körperliche Stärke ist schön und gut – aber sie ist rein äußerlich. Was den Leser tief berührt und inspiriert, ist eher innere Stärke. Und das völlig unabhängig vom Geschlecht der Figur.
Was ist eine „Frau“?
Auch hier lässt sich die Definition aufbröseln, nämlich in sex und gender:
- Sex: Rein biologisch betrachtet ist eine Frau alles, was zwei X‑Chromosome hat. Aus diesen zwei X‑Chromosomen ergibt sich eine Hormonmischung, die bestimmte körperliche Merkmale und Verhaltensweisen begünstigt.
- Gender: Gesellschaftlich betrachtet variiert die Vorstellung davon, was eine Frau ausmacht, je nach Kultur und Epoche. Das schlägt sich in der Erziehung und anderen Umwelteinflüssen nieder und begünstigt bestimmte Vorstellungen und Verhaltensweisen.
Sowohl sex als auch gender sind Gegenstand hitziger Diskussionen. Während über die primären und sekundären Geschlechtsmerkmale einer Frau in der Regel Einigkeit herrscht, ist oft unklar, welche als „weiblich“ geltenden Verhaltensweisen biologisch und welche gesellschaftlich bedingt sind.
Sicher sagen kann man nur, dass es bei Geschlechterunterschieden – selbst bei eindeutig biologischen – grundsätzlich nur um Tendenzen geht.
Ja, Männer sind tendenziell größer und stärker als Frauen. Aber es gibt auch viele große, muskulöse Frauen und kleine, schmächtige Männer.
Frauen und ihr Umfeld
Es ist daher grundsätzlich falsch, eine strenge Grenze zwischen den Geschlechtern zu ziehen. Wir sind alle in erster Linie einfach nur Menschen. Die Unterschiede sind minimal. Und ein Mann und eine Frau, die einer bestimmten Gruppe angehören (zum Beispiel einer bestimmten sozialen Schicht) haben mehr miteinander gemeinsam als mit einem Mann bzw. einer Frau aus einer anderen Gruppe.
Deswegen ist beim Erschaffen von weiblichen Figuren immer auch ihr Umfeld zu berücksichtigen.
Und beim Stichwort „Umfeld“ denken wir auch schnell an Kulturen und/oder frühere Epochen mit traditionelleren Vorstellungen von Weiblichkeit. Und wir fragen uns, inwiefern eine Frau, die in einer solchen Kultur oder Epoche einen untraditionellen Weg einschlägt, überhaupt realistisch ist.
Ohne jemandem auf die Füße treten zu wollen, würde ich an dieser Stelle aber sagen, dass eine solche Fragestellung gewissermaßen modernes Klischeedenken ist.
Denn es drängt alle Konzepte von Weiblichkeit, die es auf der Welt gab und gibt, in zwei Schubladen: „emanzipiert“ und „traditionell“. Dass es da ziemlich viele verschiedene Ausprägungen gibt, fällt gerne unter den Tisch.
Zum Beispiel kann man grob sagen, dass die Geschlechterrollen in Russland tendenziell traditioneller sind als in Deutschland. Ich stamme jedoch selbst aus Russland und muss da das ein oder andere große, dicke Aber anfügen. Am besten illustriert das ein Artikel einer deutschen Journalistin, die eine Zeit lang in Russland gearbeitet hat. Leider ist es Jahre her, dass ich diesen Artikel gelesen habe. Ich habe den Link nicht abgespeichert und seit ca. drei Jahren versuche ich, diesen Artikel wiederzufinden. Wenn Du ihn also findest, sag mir bitte Bescheid und ich verlinke ihn hier.
Aber nun zur Geschichte: Die deutsche Journalistin schreibt über Politik. Und sie merkt, dass in Deutschland viele überrascht sind, dass sie als Frau über Politik schreibt. Auch in Russland reagierten die Menschen auf sie mit Überraschung – aber nicht wegen ihres Schwerpunktes „Politik“, sondern weil sie sich nicht schminkt und keine hohen Absätze trägt. Ihre Kompetenz beim Thema Politik hat nie jemand angezweifelt.
Man kann viele Gesellschaften der unseren gegenüberstellen. Und auch, wenn wir unsere eigene Kultur in vielen Fällen für progessiver halten, müssen wir doch bedenken, dass wir das Andere stets aus einer sehr eingeschränkten Perspektive betrachten. Natürlich halten wir unsere Kultur für besser. Wir haben ihre Werte mit der Muttermilch verabreicht bekommen. Wir halten sie für die objektive Wahrheit.
Doch wenn wir über Frauen in einer anderen Kultur und/oder einer anderen Zeit schreiben wollen, müssen wir unseren Horizont ausweiten und sehr viel recherchieren:
Welches Frauenbild hat die ausgewählte Kultur/Epoche genau? Woher kommt dieses Frauenbild? Und wie äußert sich das konkret im Alltag?
Historische Vorbilder
Auch ist ein bestimmtes Frauenbild stets immer nur ein Bild. Und wie man mit einem Bild umgeht, entscheidet jedes Individuum selbst. Deswegen hat es in der Geschichte auch schon immer Frauen gegeben, die aus ihrer traditionellen Rolle herausgebrochen oder herausgefallen sind:
- Es gab Frauen, die als Männer verkleidet in den Krieg gezogen sind. Ein Beispiel aus dem Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg ist Deborah Sampson. Ein Beispiel aus den Napoleonischen Kriegen ist Nadeschda Durowa, die nach ihrer Entlarvung vom Zaren sogar ein Offizierspatent bekam und ihren Dienst fortsetzen durfte.
- Es gab aber auch Frauen, die sich gar nicht erst verkleiden mussten. Ein solches Beispiel ist Ljudmila Pawlitschenko: Mit ihren 309 Treffern gehört sie zu den effizientesten Scharfschützen des Zweiten Weltkrieges. Deswegen kennt man sie im englischsprachigen Raum auch als „Lady Death“.
- Manche Frauen wurden aber auch durch ihre kriminellen Machenschaften berühmt, so zum Beispiel die Piratinnen Mary Read und Anne Bonny. Oder auch Sofja Perowskaja, eine russische Revolutionärin, die maßgeblich an der Ermordung von Alexander II. beteiligt war.
Das waren natürlich nur einige wenige Beispiele …
- Und von Herrscherinnen und Pornokratie (d.h. Mätressenherrschaft) will gar nicht erst anfangen …
Damit halten wir fest:
Eine Frau, die ihre traditionelle Rolle verlässt, war in früheren Zeiten natürlich keine Regel. Aber das war auch nicht unmöglich.
Die Motivationen der eben aufgezählten Frauen waren dabei so vielfältig wie die Frauen selbst. Manche wurden schon früh in ihrem Leben aus unterschiedlichen Gründen als Jungen verkleidet, andere handelten aus Liebe zu jemandem … Menschenleben sind immer sehr individuell. Und so sind es auch menschliche Beweggründe.
Ich würde daher neben gründlicher Recherche zur jeweiligen Kultur bzw. Epoche auch nach Biographien von Frauen suchen, die der Figur in Deiner eigenen Geschichte ähneln:
In welchen Familienverhältnissen sind diese Frauen aufgewachsen? Wie hat sich ihr ganz persönliches Weltbild entwickelt? Welche Werte und Ideale hatten sie? Wann genau und wie sind sie zum ersten Mal aus ihrer traditionellen Rolle herausgefallen? Was haben sie dadurch gelernt?
Finde reale Vorbilder für Deine Figur, schraube dann an ihr herum und mach sie individuell. Und denke daran:
Regeln – und damit auch gesellschaftliche Rollen – mögen noch so sehr verankert sein. Doch jedes Individuum kann immer entscheiden, ob es diese Regeln befolgt. Und wenn diese Regeln aus irgendeinem Grund die persönlichen Interessen des Individuums verletzen, wird das Individuum entweder kleinlaut beigeben oder aber Mittel und Wege suchen, diese Regeln zu umgehen. Wofür das Individuum sich entscheidet, hängt vom individuellen Charakter ab.
Und daraus resultuert auch noch ein weiterer Tipp:
Überlege, was Dich dazu bringt, bestimmte Regeln zu brechen. Warum läufst Du bei Rot über die Straße? Warum spickst Du bei Prüfungen? Und warum fährst Du schwarz?
Wenn Du aus praktischen, wirtschaftlichen oder existenziellen Gründen Regeln brichst, dann können das Frauen in noch so konservativen Gesellschaften auch.
Definition: „starke Frau“
Meiner Meinung nach wird beim Erschaffen von „starken Frauen“ oft „geschlampt“: Statt eine interessante Figur zu entwickeln, wird auf Abkürzungen zurückgegriffen. Beispielweise bekommt die Frau einfach traditionell männliche Eigenschaften verpasst oder es wird direkt eine im Prinzip klischeehaft männliche Figur kreiert und ist nur rein äußerlich weiblich.
Dabei sollten „starke Frauen“ eigentlich nicht schwieriger zu erschaffen sein als „starke Männer“:
Denn eine „starke Frau“ ist vor allem ein starker Mensch weiblichen Geschlechts.
Natürlich fällt die gesellschaftliche Prägung oft anders aus als bei Männern. Doch gesellschaftliche Regeln und Richtlinien sollten auch nicht überbewertet werden. Denn wir haben ja bereits gesehen: Es gibt keine Regeln ohne Ausnahmen.
„Starke Frauen“ und interessante Frauen
Und weil Stärke rein innerlich sein kann, muss eine „starke Frau“ strenggenommen auch keine Kriegerin sein. Wenn wir uns ansehen, was Aschenputtel alles erträgt, ohne eine verbitterte Menschenhasserin zu werden, müssen wir auch sie als „starke Frau“ bezeichnen. Aber ob es sie automatisch zu einer interessanten Figur macht, steht auf einem anderen Blatt.
Dass interessante Frauenfiguren gerne aus ihrer traditionellen Rolle herausfallen, hat, denke ich, einen ganz einfachen Grund: Figuren in Konflikt mit der ganzen Gesellschaft sind einfach spannend. Denn gute Geschichten leben von Konflikten. Und wenn Figuren einen Konflikt mit ihrer eigenen Identität (zum Beispiel als Frau) haben, dann ist das umso besser: Denn so haben wir auch einen schönen inneren Konflikt.
Und das ist der Punkt, der die „starke Frau“ Aschenputtel meiner Meinung nach wirklich langweilig macht:
Sie ist stark, ja, aber sie hat keinen interessanten Konflikt. Natürlich leidet sie. Aber sie ist innerlich so rein und perfekt, dass sie von vornherein bestens ausgestattet ist, um die Unmenschlichkeit ihr gegenüber zu ertragen.
Ganz ehrlich? Ich würde zu gerne sehen, wie Aschenputtel durch die Misshandlungen seitens ihrer Familie allmählich – wie jeder normale Mensch es täte – Aggressionen kriegt. Ich will passiv aggressives Verhalten sehen, gewürzt mit Rache- und Mordfantasien. Und einen ständigen inneren Kampf, um die eigene Menschlichkeit zu bewahren. Und eine posttraumatische Belastungsstörung statt eines Happily Ever After wäre sicherlich auch spannend.
Frauen in der Literaturgeschichte
Eigentlich ist das ein Thema für ganze Literaturwissenschaftlerkarrieren. Fasst man es jedoch möglichst knapp zusammen, kann man bei der traditionellen Darstellung von Frauen zwei Grundtendenzen festhalten:
- die Heilige:
Sie ist in der Regel jung, schön und so unschuldig wie es nur möglich ist. Sie ist voller Mitgefühl, meistens religiös und natürlich Jungfrau. Typischerweise ist sie außerdem blond und blauäugig. In Geschichten ist sie der passive Love Interest des Helden, die Belohnung für seine Mühen und hat abgesehen von ihrer engelhaften Perfektion keinen nennenswerten Charakter. In eher düsteren Geschichten ist sie ein unschuldiges Opfer, das entweder grausam ermordet oder gefangen gehalten wird. - die Hure:
Sie ist die Personifikation von Sünde, Laster und allem, was schlecht ist. Dabei muss sie nicht buchstäblich eine Hure – im Sinne von: Prostituierte – sein, sondern kann auch in Gestalt einer hässlichen Hexe auftauchen. Oft ist sie aber tatsächlich schön – oder vielmehr: sexy. In diesem Fall verdreht sie Männern durch ihren Sexappeal den Kopf und treibt sie ins Verderben. Kurzum: Wie auch immer ihre Gestalt aussehen mag – Sie ist vor allem ein Monster.
Das Problem ist, dass weder die eine noch die andere Grundtendenz die Frau wirklich als Mensch darstellt. Freilich gibt es auch bei Männern eine gefährliche Klischee-Dichotomie, die wir bereits in einem früheren Artikel angesprochen haben. Doch bei den Männern ist zumindest auf der einen Seite ein Held mit Zielen und Wünschen. Wenn eine Frau etwas erreichen will, ist sie überdurchschnittlich oft eine „Hure“.
Diese Dichotomie hat auch den Nachteil, dass Frauen tatsächlich oft als reiner und unschuldiger wahrgenommen werden als sie sind. Und manche Frauen nutzen das aus, indem sie das „Unschuldige Frau als Opfer“-Klischee ausspielen. Diese beiden Schubladen liefern auch eine gute Grundlage für frustrierte Männer, die alle Frauen für Huren halten. Und auch „Slutshaming“ hat hier seine Wurzeln. Mit anderen Worten:
Die Heilige-vs.-Hure-Dichotomie entmenschlicht Frauen.
Bemerkenswerte Beispiele und ein neuer Archetyp
Interessant ist in diesem Zusammenhang die Figur der Sonja Marmeladowa aus Dostojewskis Verbrechen und Strafe. Denn sie ist eine heilige Hure:
Sie ist zutiefst religiös, unschuldig des Diebstahls beschuldigt und stigmatisiert, und sie ist eine Art Mentor-Figur für den Protagonisten Raskolnikow. Aber gleichzeitig prostituiert sie sich, um ihre Familie durchzufüttern. Im Prinzip ist das ein heiliges Märtyrium. Und dabei ist ihre Figur psychologisch realistisch: Sie ist heilig, aber nicht so perfekt wie Aschenputtel. Sie denkt durchaus an Selbstmord. Doch die Verantwortung für ihre Familie und ihre Frömmigkeit halten sie davon ab.
Interessant sind auch die Romane Juliette und Justine vom Marquis de Sade:
Juliette und Justine sind verwaiste, mittellose Schwestern, die völlig gegensätzliche Lebenswege einschlagen. Während die tugendhafte Justine von allem und jedem misshandelt wird, wird Juliette Prostituierte, begeht Verbrechen, nimmt an einer Vielzahl von Orgien teil und wird schließlich reich und glücklich. Die Vorstellung, dass die Heilige siegt und die Hure verliert, wird hiermit umgedreht.
(Eine Lektüre will ich an dieser Stelle aber nicht unbedingt empfehlen. Wir sprechen hier immerhin von einem Autor, aus dessen Namen der Begriff „Sadismus“ entstanden ist.)
In jüngerer Zeit gibt es immer wieder den Trend, Frauen mit stereotyp männlichen Eigenschaften zu versehen. Das Ergibnis sind der Archetyp des Action Girls und seine zahlreichen Untertypen: Unterm Strich also Frauen, die in traditionell männliche Domänen vordringen und – wie der Name bereits andeutet – zu Action-Kriegerinnen werden.
Es gibt dabei – wie bei jedem anderen Archetyp auch – sowohl gute als auch schlechte Umsetzungen. Das ist meiner Meinung nach ein klares Zeichen dafür, dass ein neuer Archetyp an sich das Problem nicht löst. Schlimmstenfalls erschafft es sogar eine Reihe neuer Klischees, die uns systematisch auf die Nerven gehen.
Nein … Um Klischees zu vermeiden, muss man zum wirklichen Kern des Problems vordringen.
Das „Geschlecht“ von Geschichten
Das ist natürlich eine sehr subjektive Beobachtung, aber ich würde behaupten, dass es spezifisch weibliche und spezifisch männliche Geschichten gibt: Das sind Geschichten, in denen das Geschlecht der Hauptfigur nicht durch das andere Geschlecht ersetzt werden könnte. Es geht also sehr stark darum, dass die Hauptfigur weiblich bzw. männlich ist.
- Beispiele für spezifisch weibliche Geschichten sind Mulan, Die Geisha und Anna Karenina. Diese Geschichten würden einfach nicht funktionieren, wenn ihre Protagonisten Männer wären.
- Beispiele für spezifisch männliche Geschichten sind Top Gun, Napola – Elite für den Führer und Fight Club. Hier würde es keinen Sinn ergeben, wenn die Protagonisten Frauen wären.
Solche geschlechtsspezifischen Geschichten sind meiner Meinung nach jedoch eher selten. Denn die meisten Geschichten halte ich für geschlechtsneutral: Hier kann das Geschlecht der Hauptfigur umgedreht werden, ohne dass es an der Grundstruktur der Geschichte etwas ändert.
- Beispiele für geschlechtsneutrale Geschichten sind Der Herr der Ringe, Harry Potter und Star Wars. Würde man hier das Geschlecht der Hauptfiguren umkehren, würden sich natürlich kleinere und größere Details und Plotpunkte ändern. Doch wenn sich Harriet Potter zum Beispiel in Cedric Diggory statt Cho Chang verliebt hätte, wäre es immer noch eine Geschichte von einem Kind geblieben, das das Geheimnis um den Stein der Weisen und die Kammer des Schreckens lüftet, dem Dunklen Lord entgegentreten muss, sich selbst opfert und das Böse besiegt. Das Geschlecht der Hauptfigur spielt da eher eine untergeordnete Rolle. Es geht in diesen Geschichten eben nicht darum, dass Frodo, Harry Potter und Luke Skywalker männlich sind.
- Auch viele Kriegsgeschichten, klassische Literatur und Geschichten über historische Ereignisse halte ich für im Grunde geschlechtsneutral: Dass die Figuren in der Regel männlich sind, ergibt sich historisch. In den Geschichten selbst geht es aber weniger um Männlichkeit und die Rolle des Mannes in der Gesellschaft, sondern um allgemeinmenschliche Werte und Erfahrungen – um Dinge, die Frauen in einer vergleichbaren Situation ähnlich empfinden würden.
Dass das Umswitchen der Geschlechter in solchen Geschichten tatsächlich funktionieren kann, zeigt übrigens die Disney-Adaption der Schatzinsel. Dass die Figuren im ursprünglichen Roman fast alle männlich sind, ist rein historisch bedingt. In Der Schatzplanet versetzt Disney die Geschichte in ein fantastisches Science Fiction-Setting und ersetzt Captain Smollett durch die weibliche Captain Amelia. Der Kern der Geschichte bleibt aber erhalten und auch die anderen Figuren hätten locker durch Frauen ersetzt werden können.
Das Problem in den Storytelling-Trends der Literaturgeschichte ist meiner Meinung nach nicht das Fehlen kriegerischer Frauen, sondern dass geschlechtsneutrale Geschichten viel öfter von Männern erzählen als von Frauen.
Die Männer werden somit implizit als „Standard-Geschlecht“ hingestellt. Interessante, starke weibliche Protagonisten gibt es tendenziell eher bei spezifisch weiblichen Geschichten. Allgemeinmenschliche Angelegenheiten werden systematisch männlichen Figuren überlassen.
Doch zum Glück gibt es geschlechtsneutrale Geschichten mit weiblichen Hauptfiguren in letzter Zeit immer öfter. Die Tribute von Panem ist so ein Beispiel:
Das Schöne an Katniss Everdeen ist nicht, dass sie ein Action Girl ist, sondern dass sie eine fein und glaubwürdig herausgearbeitete Figur ist. Und wenn man an dem ein oder anderen Detail schraubt, könnte Katniss auch genauso gut männlich sein und die Geschichte würde trotzdem im Großen und Ganzen funktionieren.
Einzigartige, mehrdimensionale Figuren
Nach all diesen Ausführungen lautet mein „Rezept“ für weitestgehend klischeefreie „starke Frauen“ wie folgt:
- Hänge Dich nicht an Archetypen auf und versuche nicht gezielt, eine „starke Frau“ zu erschaffen.
- Konzentriere Dich vielmehr darauf, eine starke Figur zu erschaffen. Sofern es keine spezifisch weibliche Geschichte ist, stelle das Geschlecht mehr in den Hintergrund.
- Wenn es eine spezifisch weibliche Geschichte ist und/oder das Setting die Geschlechterrolle wichtig macht, dann recherchiere die Kultur bzw. Epoche und suche reale Vorbilder.
- Denke bitte außerdem auch in anderen Punkten an Realismus: Eine noch so kämpferische Frau ist immer noch ein Mensch und damit auch für die psychischen Folgen von Gewalt anfällig. Wenn eine Frau durch das Töten traumatisiert wird, dann ist sie nicht schwach, sondern ein glaubwürdiger Mensch.
- „Starke Frauen“ müssen auch nicht unbedingt Kämpferinnen sein und/oder alles traditionell „Weibliche“ ablehnen. Denn wirkliche Stärke hat nichts mit Geschlechterstereotypen zu tun.
- Es ist übrigens auch sinnvoll, auch weibliche Nebenfiguren gut herauszuarbeiten. Wie viele weibliche Nebenfiguren eine Geschichte über eine „starke Frau“ braucht, hängt sehr stark von der Geschichte selbst ab. Manche Geschichten lassen sehr viele Frauen zu; in anderen Geschichten – beispielsweise solchen, die von als Soldaten verkleideten Frauen handeln – wird das eher schwierig. Viel wichtiger ist aber, wie die weiblichen Nebenfiguren dargestellt werden. Denn wenn nur die Heldin eine nennenswerte Persönlichkeit besitzt und die anderen Frauen nur Klischees verkörpern, hat der Autor die Probleme bei der Darstellung von Frauen offenbar immer noch nicht verstanden.
Mit anderen Worten:
Erschaffe interessante, starke und glaubwürdige Figuren weiblichen Geschlechts und reibe dem Leser um Himmels Willen nicht unter die Nase, dass es eine „starke Frau“ ist.


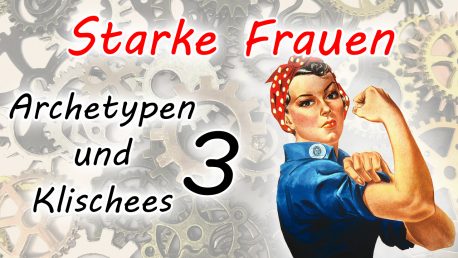
Die beste Seite die ich bis jetzt über das Schreiben gefunden habe. Übglaublich so eine gute und grosse Arbeit!
Vielen Dank.
Nora
Vielen herzlichen Dank! ❤️😊
Toller Artikel mit vielen wichtigen Punkten!
Nur eine Sache möchte ich ergänzen: Meiner Meinung nach sind nicht nur Figuren „stark“, die feste Werte haben und über ihren Schatten springen, sondern auch solche, die an ihren Werten festhalten, auch wenn alles dagegen spricht.
Eine der berührendsten Szenen in Harry Potter ist für mich, wie Harry am Ende des 5. Teils sich dagegen auflehnt, von Voldemort übernommen zu werden. Obwohl er am Boden liegt, Voldemort kräftemäßig absolut unterlegen ist, und auch gerade erst Sirius ermordet wurde, hält er an seinen Glauben an das Gute in der Welt und seine Freunde fest und überwindet so Voldemorts Macht. Bei der Szene muss ich jedes Mal wieder heulen ;_;
Danke fürs Lob!
Ich denke, feste Werte zu haben und an ihnen festzuhalten, obwohl alles dagegen spricht, ist dasselbe. Denn man kann an seinen Werten ja nur festhalten, wenn man sie hat und wenn sie fest sind. Die Szene, die Du beschreibst, passt, würde ich sagen, also durchaus zum Überwinden von Schwächen/Schatten: Harry ist geschwächt (und generell schwächer als Voldemort), aber er überwindet diese Schwäche.