Erzählungen innerhalb von Erzählungen – Man begegnet ihnen häufiger als man denkt. Und deswegen ist es interessant zu schauen, wie das verschachtelte Geflecht von Rahmenerzählungen und Binnenerzählungen funktioniert. In Genettes Erzähltheorie sind die sogenannten narrativen Ebenen eine Kategorie der Stimme und heißen extradiegetische, intradiegetische und metadiegetische Ebene. In diesem Artikel nehmen wir sie unter die Lupe.
Die Folien für dieses Video gibt es für Steady-Abonnenten und Kanalmitglieder auf YouTube als PDF zum Download.
Zur Wiederholung
Genette unterteilt die Erzählperspektive ja bekanntlich in Modus und Stimme. Um den Modus ging es im ersten Teil der Reihe. Die Stimme unterteilt Genette wiederum in drei Kategorien. Über die erste Kategorie, nämlich die der Zeit, ging es im zweiten Teil der Reihe. Die narrativen Ebenen sind die zweite Kategorie.
Narrative Ebenen: Mein peinlicher Fehler
Erstmal vorweg:
Schande über mein Haupt!
In mehreren vergangenen Artikeln bin ich mit der Terminologie durcheinander gekommen:
Wo ich zum Beispiel hätte vom intradiegetischen Erzähler reden sollen, habe ich von der intradiegetischen Ebene gesprochen. Dabei ist die Erzählung eines intradiegetischen Erzählers metadiegetisch.
Irgendwann, vor vielen Jahren, habe ich mal die Begriffe vertauscht – und leider wurde es dann zur Gewohnheit. Es ist mir leider erst bei der erneuten intensiven Beschäftigung mit dem Thema aufgefallen, dass ich jahrelang diesen Fehler mit mir herumgeschleppt habe.
Ich bitte daher um Entschuldigung und präsentiere nun, wie es richtig ist.
In den früheren Artikeln wird der Fehler nach und nach korrigiert. Bei den Videoversionen ist das leider nicht mehr möglich. Dort werde ich einen erklärenden Kommentar hinzufügen.
Narrative Ebenen: Überblick
Wenn ein Erzähler eine Erzählung erzählt, haben wir automatisch zwei Ebenen:
- Auf der ersten Ebene sind der Erzähler und sein Publikum.
- Auf der zweiten Ebene ist das Erzählte.
Zum Beispiel:
Fritzchen war gestern im Supermarkt und hat Thunfisch gekauft.
- Der Erzähler befindet sich hier auf der ersten Ebene. Genette bezeichnet sie als extradiegetische Ebene.
- Fritzchen, der Supermarkt und der Thunfisch hingegen befinden sich auf der zweiten Ebene. Genette bezeichnet sie als diegetische oder intradiegetische Ebene.
Nun spinnen wir das Beispiel nochmal weiter:
Fritzchen war gestern im Supermarkt und hat Thunfisch gekauft. Auf dem Weg nach Hause traf er Lieschen und sie erzählte ihm:
„Ich habe mir vor einigen Monaten ein Kätzchen angeschafft. Es war anfangs noch recht schüchtern, hat sich mittlerweile aber gut eingelebt.“
- Mit Lieschens Erzählung von ihrem Kätzchen haben wir nun eine dritte Ebene: die metadiegetische Ebene.
- Wenn Lieschen nun von ihrer Schwester Maria erzählt, die ihr eine Geschichte von ihrem Hund erzählt hat, haben wir eine metametadiegetische Ebene.
- Und wenn Maria innerhalb von Lieschens Erzählung dann von ihrem Freund berichtet, der ihr etwas über seine Wellensittiche erzählt hat, haben wir eine metametametadiegetische Ebene.
- Und so weiter.
Weil es sich um Erzählungen innerhalb von Erzählungen handelt, wirkt so eine Struktur sehr verschachtelt. Jede „Schachtel“ bzw. Binnenerzählung hat dabei einen eigenen Erzähler mit seiner eigenen Erzählperspektive.
Um das Ganze also noch einmal zusammenzufassen:
- Der extradiegetische Erzähler erzählt die intradiegetische Erzählung.
- Ein intradiegetischer Erzähler erzählt eine metadiegetische Erzählung.
- Ein metadiegetischer Erzähler erzählt eine metametadiegetische Erzählung.
- Und so weiter.
Zugegeben, man verheddert sich hier schon sehr leicht. Genau das ist mir ja auch passiert. Ich hoffe also, dass Du durch diese Übersicht von einem solchen Missgeschick verschont bleibst.
Nun gehen wir aber weiter zur Einzelbetrachtung der narrativen Ebenen …
Extradiegetische Ebene
Die extradiegetische Ebene ist, wie gesagt, das Habitat des extradiegetischen Erzählers; das heißt salopp: des fiktiven Urhebers des ganzen Werkes. Dieser kann dabei völlig unterschiedlich auftreten:
- Der extradiegetische Erzähler kann sich natürlich unsichtbar machen und die Erzählung und die Figuren in den Vordergrund schieben. Im Extremfall kann er sich komplett auf das Innenleben einer Figur fixieren und ihre Wertungen übernehmen:
„Ramon wusste, Angel konnte es mit dem Messer niemals mit ihm aufnehmen, nicht Mann gegen Mann. Angel hatte die Hosen voll!“
Myron Levoy: Ein Schatten wie ein Leopard, Kapitel 11.
- Sich sichtbar machen kann und darf sich der extradiegetische Erzähler aber natürlich auch. Im Extremfall wendet er sich sogar direkt an den Leser:
„Erlauben Sie, mein Leser,
mich mit der älteren Schwester zu befassen.“
Alexander Puschkin: Eugen Onegin, Zweites Buch, Strophe XXIII.
- Mehr noch, ein extradiegetischer Erzähler kann seine Erzählung als faktual ausgeben, und dabei selbst alles Mögliche sein: von einem neugierigen Individuum, das sonderbare Umstände erforscht und seine Erkenntnisse nun niedergeschrieben hat, bis hin zum Herausgeber einer Briefkorrespondenz, wie er in Briefromanen vorkommt.
„Das Phantom der Oper hat wirklich existiert. […] Bei meinen Nachforschungen in den Archiven der Académie nationale de Musique […]“
Gaston Leroux: Das Phantom der Oper, Prolog.
„Was ich von der Geschichte des armen Werther nur habe auffinden können, habe ich mit Fleiß gesammelt und lege es euch hier vor, und weiß, dass ihr mir’s danken werdet.“
Johann Wolfgang Goethe: Die Leiden des jungen Werther.
- Eine sehr spezielle Spezies des extradiegetischen Erzählers ist der Autor-Erzähler, der sich einerseits als Autor eines Werkes ausgibt, aber gleichzeitig auch als Figur in der Erzählung vorkommt:
Der fiktive Robinson Crusoe erzählt im Roman von Daniel Defoe seine eigene Geschichte.
Intradiegetische Ebene
Das, was der extradiegetische Erzähler erzählt, ist die intradiegetische Ebene. In den meisten Erzählungen ist das die Ebene, auf der die eigentliche Geschichte stattfindet.
Findet die eigentliche Geschichte auf der metadiegetischen Ebene statt, bildet die intradiegetische Ebene die Rahmenerzählung:
In Remarques Roman Die Nacht von Lissabon, zum Beispiel, begegnet auf der intradiegetischen Ebene der Ich-Erzähler einem mysteriösen Mann namens Josef Schwarz. Dieser erzählt ihm seine eigene Geschichte – und diese ist die eigentliche Geschichte des Romans.
Zu diesem Roman habe ich übrigens bereits eine Erzählanalyse gemacht. Die verschachtelte Stuktur finde ich hier nämlich grandios angewandt und deswegen kann ich einen Blick in den Roman und in meine Analyse dessen nur empfehlen.
Metadiegetische Ebene
Gibt es in der intradiegetischen Erzählung eine Binnenerzählung, so liegt diese auf der metadiegetischen Ebene. Interessant ist hierbei das Verhältnis zwischen den beiden Ebenen. Genette beobachtet an dieser Stelle drei Typen:
- Zwischen der intradiegetischen Ebene und der metadiegetischen Ebene besteht ein Kausalverhältnis:
In der metadiegetischen Erzählung wird berichtet, wie es zur Situation auf der intradiegetischen Ebene gekommen ist. Charakteristisch ist dabei, dass die metadiegetische Erzählung an der Situation nichts ändert:
In den Gesängen IX bis XII der Odyssee erzählt Odysseus den Phaiaken, wie er bei ihnen gelandet ist. Dadurch erfahren sie diesen Teil seiner Geschichte. Das ändert aber nicht wirklich etwas am Status Quo, dass er nun mal bei ihnen gelandet ist.
- Die beiden Ebenen sind thematisch miteinander verknüpft:
Diese Verknüpfung beruht auf Kontrast oder Ähnlichkeit, wie das zum Beispiel bei Gleichnissen und Parabeln der Fall ist. Gerne wird eine solche metadiegetische Erzählung von einer Figur eingebracht, um die Situation auf der intradiegetischen Ebene zu beeinflussen. Genette führt hier die Parabel vom Magen und den Gliedern als Beispiel an:
Der römische Geschichtsschreiber Titus Livius beschreibt, wie Agrippa Menenius Lanatus die Plebejer während der Standeskämpfe im Jahr 494 v. Chr. von der Wichtigkeit des Patrizierstandes überzeugt, indem er ihnen die Parabel vom Magen und den Gliedern vorträgt.
- Zwischen den Ebenen besteht keine explizite Beziehung.
Was in der metadiegetischen Erzählung erzählt wird, ist auf der intradiegetischen Ebene somit eher wenig relevant. Vielmehr geht es darum, dass etwas erzählt wird, also um den Akt des Erzählens an sich. Ziel und Effekt einer solchen metadiegetischen Erzählung ist Zerstreuung und/oder Hinauszögern. Tausendundeine Nacht ist hier das berühmteste Beispiel:
Auf der intradiegetischen Ebene zögert Scheherazade durch ihre metadiegetischen Erzählungen ihren Tod hinaus. Was sie konkret erzählt, ist eigentlich unwichtig. Es kommt nur darauf an, dass die Erzählungen interessant genug sind, um den Sultan zu fesseln.
Nun denn. Bei der näheren Betrachtung der drei ersten Ebenen möchte ich es belassen. Das Prinzip sollte jetzt klar sein. Zumal wir im Zusammenhang mit den narrativen Ebenen unbedingt noch auf ein ganz besonderes Phänomen zu sprechen kommen sollten …
Metalepse
Die „Grenzen“ zwischen den Ebenen sind nicht so unüberwindbar wie sie auf den ersten Blick vielleicht erscheinen mögen. Wenn diese „Grenzen“ also aufgebrochen werden und zwei Ebenen sich vermischen, nennt Genette es Metalepse.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie eine solche Vermischung passieren kann:
- An erster Stelle ist die Metalepse des Autors zu erwähnen. Hier tut der Erzähler so, als wäre er der Autor und als würde er selbst bewirken, was in der Geschichte passiert. Statt also von Dingen zu berichten, die passiert sind, überlegt ein solcher Erzähler zum Beispiel explizit, was er mit seinen Figuren alles anstellen könnte:
„Wer könnte mich verhindern, den Herrn zu verheiraten und zum Hahnrei zu machen, Jakob nach Westindien segeln zu lassen, seinen Herrn ebenfalls dahin zu schicken und beide dann auf einem und demselben Schiffe nach Frankreich zurückzuführen?“
Denis Diderot: Jakob und sein Herr, Kapitel 1.
- Eine Metalepse ist auch gegeben, wenn der Erzähler so tut, als geschehe der Akt der Erzählung zeitgleich mit der Geschichte. Und da eine Geschichte auch recht ereignislose Momente hat und man den Leser offenbar nicht mit solchen langweilen darf, fühlt der Erzähler die Notwendigkeit, diese Ereignislosigkeit in der Geschichte durch Abschweifungen auszufüllen. In einem solchen Fall heißt es im Text zum Beispiel explizit:
„[I]ch begnüge mich hier, während die Blindschleiche hält und der Schaffner Doncières, Grattevast, Maineville ausruft, niederzuschreiben, was diese kleinen Küstenorte oder jene Garnison mir in Erinnerung rufen.“
Marcel Proust: Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, Drittes Kapitel.
- Eine Metalepse etwas anderer Natur entsteht, wenn Figuren einer Ebene aus ihrer jeweiligen Erzählung heraussteigen und mit der vorherigen Ebene interagieren. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn eine Figur auf der intradiegetischen Ebene die vierte Wand durchbricht und sich direkt an den Leser wendet, der sich ja eigentlich auf der extradiegetischen Ebene befindet:
Ein nicht literarisches, aber dafür aktuelles Beispiel ist Deadpool. Er ist ein Superheld, der tatsächlich weiß, dass er eine Comic- bzw. Filmfigur ist und sich immer wieder der Kamera zuwendet und das Publikum anquasselt.
- In einigen Fällen entsteht eine Metalepse aber auch aus Gründen der Bequemlichkeit. In Platons Text Theaitetos, zum Beispiel, unterhalten sich Euklid und Terpsion, zwei ehemalige Schüler des Sokrates. Dabei erzählt Euklid von den Gesprächen, die er mit Sokrates hatte. In diesen Gesprächen erzählte ihm Sokrates von einer Diskussion mit den Mathematikern Theodoros und Theaitetos. Euklid hat Sokrates’ Erzählung von dem Gespräch aufgezeichnet, jedoch mit einem besonderen Twist:
„Dieses hier also, Terpsion, ist das Buch. Ich habe aber das Gespräch solchergestalt abgefaßt, nicht daß Sokrates es mir erzählt, wie er es mir doch erzählt hat, sondern so, daß er wirklich mit denen redet, welche er als Unterredner nannte. […] Damit nämlich in dem geschriebenen Aufsatz die Nachweisungen zwischen dem Gespräch nicht beschwerlich fielen, wie wenn er selbst Sokrates geredet das »Da sprach ich« oder »Darauf sagte ich«, und von dem Antwortenden »Das gab er zu«, und »Darin wollte er nicht beistimmen«, deshalb habe ich geschrieben, als ob er unmittelbar mit Jenen redete mit Hinweglassung aller dieser Dinge.“
Platon: Platons Werke. Zweiter Theil, übersetzt von Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, Berlin 1817–26 (Ausgabe 1984–87).
Das heißt vereinfacht: Obwohl Euklid von der Diskussion nur aus Sokrates’ Erzählung weiß, lässt er diese Ebene in seiner eigenen Wiedergabe des Ganzen weg. Statt zu schreiben: „Das und das hat Sokrates mir erzählt“, gibt er die Diskussion zwischen Sokrates und den beiden Mathematikern wörtlich wieder. Damit tritt die metametadiegetische Ebene an die Stelle der metadiegetischen. Dadurch wirkt das Werk insgesamt deutlich weniger verschachtelt. Genette nennt diese Erzählform reduziert metadiegetisch oder pseudo-diegetisch.
Die Schönheit der Metalepse
Während die narrativen Ebenen an sich einfach nur eine Terminologie für das natürliche Phänomen von verschachtelten Erzählungen liefern, geben Metalepsen dem Ganzen eine beinahe schon philosophische Dimension. Denn spätestens wenn fiktive Figuren zu realen Lesern sprechen und die Erzählinstanz explizit Gott spielt, entsteht die Frage:
Was ist real und was ist Fiktion? Sind wir reale Menschen nicht doch irgendwie Figuren in irgendeiner Geschichte? Ist die extradiegetische Ebene nicht irgendwie doch diegetisch?
Ich würde sagen, die narrativen Ebenen und vor allem die Metalepse sind etwas, über das man nicht zu viel nachdenken darf. Denn irgendwann kommt der Punkt, wo man sich nur noch im Kreis bewegt und die Ebenen durcheinanderbringt. Aber andererseits:
Verschachtelte Strukturen sind bei manchen literarischen Werken zumindest teilweise für deren Charme verantwortlich.


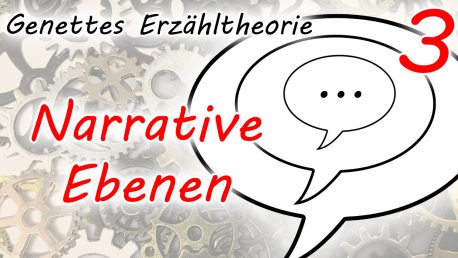
Guten Tag,
Vielen Dank für diese sehr tolle Zusammenfassung! Es war sehr hilfreich.
Nur schade, dass nichts referiert ist. Genette hat viel geschrieben und man kann nicht sicher sein, auf welche Werke Sie sich bezogen haben.
Vielen Dank fürs Lob!
Auf Verweise habe ich verzichtet, weil das Ganze hier nicht wissenschaftlich bzw. für Nichtwissenschaftler „genießbar“ sein soll. Aber ich reiche den Verweis gerne nach: Grob zusammengefasst habe ich hier nur die Kapitel „5. Stimme: Narrative Ebenen“, „5. Stimme: Die metadiegetische Erzählung“ und „5. Stimme: Metalepsen“ in Genettes „Die Erzählung“. Plus eigene Beispiele, vereinfachte Formulierungen und eigene Meinung (vor allem am Ende).
Hallo ! 🙂 ich habe eine Frage an dich! Kann ich dich irgendwie bitte kontaktieren? ich muss Metalepsen im Buch „Il consiglio d´Egitto“ von Schiaschia finden für die Uni.. Leider finde ich nicht wirklich welche. Kannst du mir bitte helfen? Ich wäre dir sehr dankbar! LG, Larissa
Hallo Larissa, meine Kontaktdaten findest Du hier: https://die-schreibtechnikerin.de/kontakt/. Allerdings leiste ich seit einiger Zeit keine Hilfe bei Hausarbeiten oder Ähnlichem mehr. Dazu habe ich einfach keine Zeit. Ich hoffe, Du hast Verständnis.
Hallo,
vielen Dank für den so hilfreichen und gut verständlichen Text! Vor allem die Beispiele haben mir sehr geholfen, das Thema zu verstehen!
Eine Frage hätte ich noch: Eine Erzählung auf metadiegetischer Ebene ist ja eine Erzählung innerhalb einer Erzählung, also innerhalb der intradiegetischen Ebene. Muss das unbedingt eine „Erzählung“ sein oder kann das auch ein Traum sein? Also wenn jemand innerhalb der intradiegetischen Ebene träumt, ist der Traum dann die metadiegetische Ebene oder immer noch die intradiegetische Ebene?
Vielen Dank fürs Lob! 😊
Zu Deiner Frage: Bei den Ebenen geht es um buchstäbliche Erzählungen mit einem Erzähler. Wenn also eine Figur der intradiegetischen Ebene von dem Traum erzählt (mündlich oder schriftlich), dann ist das eine metadiegetische Erzählung. Wenn es aber der normale extradiegetische Erzähler ist, der erzählt, wie eine Figur diesen Traum träumt, dann ist der Traum immer noch auf der intradiegetischen Ebene.