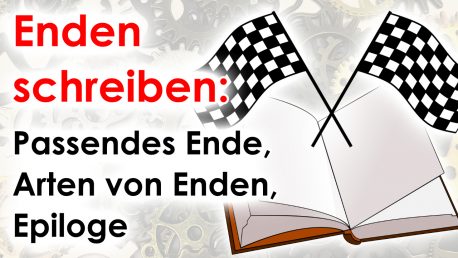Alle Dinge haben ein Ende und so endet auch jede Geschichte einmal. Aber was unterscheidet ein gutes Ende von einem schlechten Ende? Welche Arten von Enden gibt es? Wann ist ein Epilog sinnvoll? Und wieso können schlecht gemachte Enden grandiose Geschichten zerstören? Diese Fragen und mehr klären wir in diesem Artikel.
Die Folien für dieses Video gibt es für Steady-Abonnenten und Kanalmitglieder auf YouTube als PDF zum Download.
Es war einmal ein Desaster namens Game of Thrones: eine erfolgreiche Fernsehserie, beruhend auf einer hervorragend geschriebenen Buchreihe. Eine spannende Handlung, tiefgründige Figuren, facettenreiches World-Building – alles war da. Von Publikum und Kritikern gleichermaßen gelobt, dominierte Game of Thrones die internationale Popkultur. Bis ihr die Buchvorlage ausging und die Macher der Serie ein Finale zusammenschusterten, das ganz und gar nicht passte. Und so kam es, dass der Welterfolg ein grausames Ende fand. Niemand mehr mag sich an diese Enttäuschung erinnern – und wenn doch, dann eben als Enttäuschung bzw. Desaster.
Aber wir können sie auch als Lektion begreifen, nämlich dass
ein schlecht gemachtes Ende eine anderweitig sonst noch grandiose Geschichte komplett zerstören kann.
Deswegen besprechen wir heute, worauf wir achten sollten, wenn wir unsere Werke ans Ziel führen: Was macht ein gutes Ende aus? Welche Aspekte müssen wir bedenken? Und welche Arten von Enden gibt es?
Packen wir’s an!
Was ist ein gutes Ende?
Ein gutes Ende ist vor allem ein emotionaler Höhepunkt. Wenn man sich eine Geschichte als Schiff vorstellt, dann ist ein Ende der Zielhafen – also das, wo der Plot hinsteuert. Alle Elemente der Geschichte arbeiten darauf hin. Und dann kulminiert alles in einem großen Ausrufezeichen, das die Aussage der Erzählung transportiert.
Dieser Punkt mit der Aussage sollte dabei nicht unterschätzt werden. Ich weiß ja nicht, wie es Dir geht, aber ich habe schon so manches Mal eine Geschichte konsumiert, es genossen … aber dann kam das Ende, die zentralen Fragen wurden aufgelöst, die verschiedenen Plotlinien zu ihrem Ende geführt und – nichts. Nur die quälende Frage: „Äh, okay … Und wozu habe ich das jetzt gelesen/geschaut/was auch immer?“
Du weißt schon, was ich meine: Geschichten, die einfach nur existieren, die man einfach wegknuspert wie Popcorn und sich dann wichtigeren Dingen zuwendet. Geschichten mit einem Ende, das vielleicht die Neugier befriedigt, wie das Ganze ausgeht – wer der Mörder ist, zum Beispiel –, die einen darüber hinaus aber nicht weiter beschäftigen.
Es ist nicht verwerflich, solche „Knuspergeschichten“ zu schreiben. Aber man sollte nicht damit rechnen, dass sie in Erinnerung bleiben:
Denn was sich in die Erinnerung einbrennt, sind emotionale Höhepunkte, die deswegen solche sind, weil sie dem Leser persönlich etwas bedeuten.
Weil ihm die Figuren ans Herz gewachsen sind; weil er sich vom zentralen Konflikt und den Themen persönlich angesprochen fühlt; weil die Geschichte – ihre Aussage – ihm etwas fürs Leben mitgibt, sei es eine neue Perspektive, eine Idee oder einfach nur neuen Mut, um sich den Herausforderungen den Lebens zu stellen.
Das Ende einer Geschichte ist – wie bereits angedeutet – sehr eng mit der Aussage verknüpft.
Und um eine Aussage zu treffen, muss man erst mal überhaupt etwas zu sagen haben. – Und hier kommt der Aspekt der Lebenserfahrung ins Spiel. Der Erkenntnishorizont des Autors bezüglich unserer Welt und der Menschen darin. Denn eine gute Geschichte mit einem entsprechend guten Ende ist mehr als bloß ein Hirngespinst, in dem einfach etwas passiert. Auf die eine oder andere, eine ernste oder lustige, direkte oder indirekte, fantasievolle oder wirklichkeitsgetreue Weise spiegelt sie die Realität, sagt etwas über uns selbst und trägt mehr oder weniger zur Diskussion bei, wer wir eigentlich sind und wozu wir existieren – weil diese Grübeleien es sind, die uns als Menschen ausmachen. Und Geschichten, die viele Rezipienten berühren, – seien sie auch noch so simpel und oberflächlich – haben – ob bewusst oder unbewusst – durchaus diese philosophische Ebene.
Doch sprechen wir über Botschaften von Geschichten und den Tellerrand des Autors ein andermal. Was ich an dieser Stelle festhalten möchte, ist, dass
ein gutes Ende nicht einfach der Punkt ist, an dem die Erzählung abbricht, sondern an dem alles zusammenläuft und kulminiert.
Die Elemente, die kulminieren, sind dabei natürlich Dinge, die im früheren Verlauf der Erzählung eingeführt wurden. Soll heißen:
Anfang und Hauptteil einer Geschichte müssen zum Ende passen bzw. das Ende muss zum Anfang und Hauptteil passen.
Wie machen wir es also passend?
Ein passendes Ende finden
Am wichtigsten ist natürlich die Prämisse. – Denn sie ist es, die das zentrale Thema, den Plot, den Arc des Protagonisten und die Botschaft unter einen Hut bekommt. Das Ende ist ein wesentlicher Teil der Prämisse, denn wie wir gleich noch sehen werden, kann das Ende das komplette Konzept einer Geschichte verändern.
Konkret bedeutet das zum Beispiel, dass das Ende zur Grundstimmung der Geschichte passen muss. Wenn Du eine locker-flockige Romanze schreibst, wäre ein tragisches Ende im Stil von Romeo und Julia völlig fehl am Platz. Denn das stößt die Leser nicht nur vor den Kopf, sondern passt auch nicht zu den Themen und der Intention, mit denen die Geschichte „verkauft“ wurde: Die Leser bleiben bis zum Ende dabei, weil die Geschichte ihnen ein gutes Gefühl und Optimismus für ihr eigenes Leben vermittelt. Ein Doppelselbstmord würde sich da wie ein Schlag ins Gesicht anfühlen und man kann es den Lesern dann nicht verübeln, wenn sie sich betrogen vorkommen.
Anders sieht es aber natürlich aus, wenn Du im Verlauf der scheinbar heiteren Geschichte immer mal wieder düstere Töne anschlägst: Zum Beispiel könnte die locker-flockige Romanze für die Figuren eine Realitätsflucht darstellen und ihr Scheitern am Ende könnte dann als Botschaft an den Leser verpackt werden, dass er sich seinen Problemen gefälligst stellen muss, wenn er nicht auch so enden will. Und weil in dieser Version ja von Anfang an düstere Zwischenklänge auftreten, ist das tragische Ende nur eine Eskalation dieser Stimmung, kein Stimmungswechsel.
Ein Festhalten an der Prämisse bedeutet außerdem, dass es zur Entwicklung der Figuren passen muss. Wenn Jaime Lannister sich in Game of Thrones erst zu einem besseren Menschen entwickelt, sich am Ende aber plötzlich nicht mehr um das Wohl der Menschen kümmert und in die toxische Beziehung zu seiner Schwester zurückkriecht, dann ist das nicht etwa ein flacher Arc, sondern eine frustrierende und unlogische Rückentwicklung. Soll also heißen: Wenn eine wesentliche Charakterentwicklung stattfindet, dann muss sie auch am Ende eine wichtige Rolle spielen. – Denn wozu sonst hat man als Leser dann mitgefiebert? Und überhaupt: Was für eine Aussage transportiert so eine plötzliche und unmotivierte Rückentwicklung? – Gar keine! Und wir haben ja bereits gesagt: Eine gute Geschichte mit einem entsprechend guten Ende ist mehr als bloß ein Hirngespinst, in dem einfach etwas passiert.
Ein zur Prämisse passendes Ende bedeutet nicht zuletzt, dass die zentralen Fragen – also die Fragen rund um die Prämisse – beantwortet werden müssen. Denn sonst bleibt der Leser unzufrieden mit viel zu vielen Fragezeichen im Kopf zurück. Es muss zwar nicht jede Kleinigkeit beantwortet werden – manche Fragen sind vielleicht einfach nicht relevant, werden in einer Fortsetzung beantwortet oder sollen auf ewig ein Geheimnis bleiben –, aber die wesentlichen Fragen – also wie gesagt: rund um die Prämisse – gehören beantwortet, Charakterarcs gehören abgeschlossen und ein neuer Status quo muss etabliert werden.
Idealerweise sollte das Ende dabei so kurz und knackig wie möglich sein: Ein Höhepunkt ist nämlich – man glaubt’s nicht! – vor allem ein Punkt und wenn er in eine Ebene ausartet, dann wird es monoton; das Auf und Ab der Gefühle verflüchtigt sich. Deswegen lohnt es sich, den Plot nicht allzu kompliziert zu machen, damit möglichst alle Konflikte und Fragen zusammen aufgelöst werden können: Je mehr Fliegen Du mit einer Klappe geschlagen bekommst, desto besser – und je mehr Fliegen Du hast, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie unter eine einzige Klappe passen.
Alternativ kannst Du aber natürlich auch schauen, ob Du nicht irgendwie eine größere Klappe benutzen kannst: Bei Buchreihen mit sehr langen und sehr komplizierten Plots fungiert gerne der letzte Band als Höhepunkt. Er hat zwar seine eigenen Höhen und Tiefen und einen internen Höhepunkt, aber bezogen auf die Gesamtgeschichte ist der gesamte Band der Höhepunkt.
In einigen Ausnahmefällen kann es aber auch verzeihlich sein, das Ende auszudehnen, wie es im Herrn der Ringe passiert ist – sowohl in den Büchern als auch in den Filmen von Peter Jackson: In den Büchern gibt es nach der Zerstörung des Rings noch einen ganzen Arc, in dem das Auenland befreit werden muss. Und obwohl es auch tatsächlich befreit wird, wird die Friede-Freude-Eierkuchen-Stimmung dennoch gedämpft: Denn selbst nach dem Fall Saurons existiert das Böse weiter, sei es auch in unscheinbaren Schlupfwinkeln. Diese Dämpfung gibt es auch in der Verfilmung, wo die Befreiung des Auenlandes zwar weggelassen wurde, Frodos Trauma, seine immer noch schmerzende Wunde, aber weiterhin erhalten blieb: Die „Guten“ haben zwar einen grandiosen Sieg errungen, aber es ist eben nicht alles gut. Das Böse hat unheilbare Spuren hinterlassen und die Magie schwindet aus Mittelerde für immer. Außerdem ist das Ende sowohl in den Büchern als auch in den Filmen sehr langgezogen – ich habe bei der Verfilmung 15 Stellen gezählt an denen in anderen Filmen der Abspann beginnen würde, im Herrn der Ringe die Geschichte aber munter weitergeht. Das ist zwar einerseits zum Schmunzeln, bei einer Geschichte mit solchen Ausmaßen in Bezug auf Figuren und Orte aber durchaus eine Notwendigkeit: Ich bezweifle, dass die Millionen von Zuschauern sich nach Jahren des Mitfieberns mit einer schnellen Montage abgefunden hätten. Eine große Geschichte kann es sich eben leisten, langsam auszuklingen.
Das wären nur einige Punkte die mit der Prämisse einhergehen – wir könnten noch mehr aufzählen, beispielweise dass man auch bei der Erschaffung von Nebenfiguren die Prämisse und das Ende im Hinterkopf haben und überlegen sollte, ob diese eine konkrete Figur wirklich zu existieren braucht. Das alles ist in der Botschaft „Halte Dich an Deine Prämisse!“ aber implizit eingeschlossen:
Mache einfach bei jedem Element, das Du einführst, einen Gegencheck, ob es wirklich zur Prämisse passt!
Und das kann im Übrigen auch scheinbar rein kosmetisch sein:
Der Herr der Ringe endet zum Beispiel mit der Szene, in der Sam nach dem Abschied von Frodo nach Hause kommt und seine Familie wiedersieht. Oberflächlich betrachtet brauchen wir diese Szene nicht: Jeder Leser und Zuschauer mit intaktem Hirm würde sich denken können, dass Sam, Merry und Pippin ins Auenland zurückgekehrt sind. Aber bei einem guten Ende geht es eben nicht nur um die reine Handlung …
Die eigentliche Geschichte im Herrn der Ringe beginnt in der Idylle des Auenlandes. Und sie endet auch in der Idylle der Auenlandes. Das ist eine unzeitliche Verknüpfung, deren Bedeutung wir in den Unterschieden erkennen: Die „neue“ Idylle am Ende ist ohne Frodo, denn er war mit seiner Wunde ein letztes Überbleibsel des alten Status quo. Der neue Status quo ist Sam – das Ende ist also eine andere Idylle, die sich nur nach einem letzten Verlust etablieren kann. Würde die Erzählung in den Grauen Anfurten abbrechen, würde sie zwar mit Frodos Erlösung, aber auch mit seinem Verlust enden; mit Sams Rückkehr und dem Wiedersehen mit seiner Familie lautet die mitschwingende Botschaft dagegen eher: „Es wurde viel verloren, aber es wurde auch viel gewonnen.“ – Und das ist ein Gedanke, der sich durch das ganze Werk zieht in Form von immerwährender Hoffnung selbst in den dunkelsten Stunden; in Form von Mut und Zuversicht, während die Welt um einen herum untergeht. Oder anders formuliert:
„Aber letzten Endes geht auch er vorüber, dieser Schatten. Selbst die Dunkelheit muss weichen. Ein neuer Tag wird kommen und wenn die Sonne scheint, wird sie umso heller scheinen.“
Sam in Der Herr der Ringe: Die zwei Türme von Peter Jackson.
Arten von Enden
Was mit der Prämisse natürlich auch zusammenhängt, ist die Entscheidung für ein glückliches, unglückliches, bittersüßes oder offenes Ende. Auf der Seite der Rezipienten gibt es hierbei oft individuelle Vorlieben – während manche sich ein gemütliches Happy End wünschen, wollen andere lieber Rotz und Wasser heulen –, aber an sich ist kein Typ besser als die anderen:
Denn sie alle können gleichermaßen interessant sein, wenn sie zu ihrer jeweiligen Geschichte passen.
Und interessant ist ein Ende vor allem durch die Aussage bzw. Botschaft, die es ja transportiert. Und das bedeutet:
Veränderst Du das Ende, veränderst Du die ganze Geschichte.
Schauen wir uns die verschiedenen Arten von Enden also genauer an …
Eindeutige Enden: glücklich oder unglücklich
Ein glückliches oder ein unglückliches Ende transportiert oft eine eindeutige Botschaft:
Der Konflikt der Geschichte besteht darin, dass der Protagonist die richtige Entscheidung fällen muss. Es gibt ein Richtig und Falsch und die Entscheidungen des Protagonisten werden belohnt oder bestraft. Die Geschichte dient also der Vermittlung von moralischen Werten – und zwar als anschauliches Beispiel ohne Moralpredigt, ganz nach dem Motto: „Show, don’t tell!“
Nehmen wir also an, unsere Geschichte handelt von Lieschen, die ihren ungesunden Corona-Speck loswerden möchte:
- Wenn sie die richtigen Entscheidungen trifft, sich gesund ernährt und sich regelmäßig bewegt, dann wird sie am Ende belohnt und passt zum Beispiel wieder in ihre Lieblingshose. Es gibt also ein Happy End.
- Wenn sie aber die falschen Entscheidungen trifft, auf ihrer Couch faulenzt und Süßigkeiten in sich reinschaufelt, dann wird sie mit einem unglücklichen Ende bestraft, in dem sie noch dicker wird und vielleicht sogar Diabetes kriegt.
Das ist aber zugegebenermaßen ziemlich schwarz-weiß. Und während eine solche Herangehensweise durchaus legitim ist und sich für viele Geschichten anbietet, erfordern andere Erzählungen mehr Nuancen. – Und diese kann man einbauen, indem man weitere, weniger offensichtliche Schichten bzw. Aspekte hinzufügt: Ich spreche hier vor allem über den feinen Unterschied zwischen dem, was eine Figur will, und dem, was sie eigentlich braucht. Also eine komplexere Motivation.
- So könnte Lieschen zum Beispiel an ihrer Diät scheitern und trotzdem ein Happy End erleben: Am Anfang mag das Abnehmen ihr Ziel sein. Im Verlauf der Geschichte erkennt sie aber vielleicht, dass es ihr nicht um ihr körperliches Wohlbefinden geht, sondern darum, was andere von ihr denken. Und dass die Diät, die sie streng durchpeitscht, sie unglücklich macht. Das glückliche Ende würde also darin bestehen, dass sie sich innerlich von der Meinung anderer löst und sich in ihrem molligen Körper wohlfühlt.
- Ähnlich kann Lieschen auch für das Bestehen der Diät bestraft werden, in dem sie in ihrer Unsicherheit um ihren Körper weit über das Ziel hinausschießt und magersüchtig wird. Sie erreicht zwar ihr oberflächliches Ziel, übersieht aber ihr eigentliches Bedürfnis bzw. die Notwendigkeit, sich selbst so zu lieben, wie sie ist.
Wie Du also siehst, wird das Schwarz-Weiß hier durch Grautöne aufgeweicht. Es gibt zwar immer noch Tendenzen, was richtig und was falsch ist, aber es ist nicht mehr so eindeutig: Es gibt immer auch ein Aber. Dabei ist die Botschaft der Geschichte allerdings immer noch klar, da sie im Prinzip dazu aufruft, seine Ziele nicht blind zu verfolgen, sondern das „Kleingedruckte“ zu lesen.
Ambivalente Enden: bittersüß
Das Schwarz-Weiß verschwimmt noch mehr,
wenn die Kategorien von Richtig und Falsch mehr oder weniger komplett wegbrechen bzw. wenn die Entscheidung, was richtig und was falsch ist, dem Leser überlassen wird. Und das geht nur mit einem Ende, das nicht eindeutig ist.
Dabei kann der Leser immer noch subtil manipuliert werden, damit er das aus der Sicht des Autors „richtige“ Richtig als solches erkennt.
- Ein Beispiel für so ein bittersüßes Ende wäre, wenn Lieschen ihre Diät durchhält, die Motivation dahinter aber darin besteht, Fritzchen zu gefallen, der aber, wie sich herausstellt, eher auf molligere Frauen steht. Je nachdem, ob das Ende mehr in die bittere oder süße Richtung driftet, verschiebt sich auch die Botschaft des Werks:
- Bei einem eher bitteren Ende würde sich Lieschen über ihren gesünderen Lebensstil freuen, dann aber mit dem Twist konfrontiert werden, dass Fritzchen sie nicht mehr attraktiv findet. Sie hat zwar etwas Wertvolles gewonnen, aber wenn die Geschichte mit dem Verlust endet, dann kann sich auch der Leser nicht wirklich über das Gewonnene freuen: Denn hier wird Fritzchen gegenüber Lieschens Gesundheit mehr Priorität beigemessen.
- Bei einem eher süßen Ende werden die Prioritäten umgekehrt: Zwar haben wir auch hier am Ende den Twist, dass Fritzchen die Protagonistin nicht mehr hübsch findet, aber die Geschichte endet mit Lieschens Einsicht, dass sie durch ihre Diät etwas viel Wertvolleres gewonnen hat als Fritzchens Zuneigung. Beim Lesen findet man es zwar schade, dass sie ihren Love-Interest nicht bekommen hat, aber letztendlich freut man sich für sie.
Ambivalente Enden: offen
Willst Du hingegen auch den letzten Rest von Richtig und Falsch verwischen, dann käme ein offenes Ende infrage:
Hier wird die Bewertung der Entscheidungen ausschließlich dem Leser überlassen, was bei diesem oft für ein mulmiges Gefühl im Magen und einen rauchenden Kopf sorgt.
Soll heißen:
Über ein gut gemachtes offenes Ende grübelt und diskutiert man sicherlich am meisten und am längsten.
- Ein Beispiel für ein offenes Ende wäre, wenn Lieschen zwar erfolgreich abnimmt, sich gleichzeitig aber erste Anzeichen des nächsten Lockdowns andeuten. Und dann bricht die Geschichte ab. Die Frage, ob Lieschen wieder zunehmen wird und ob die Diät sich somit überhaupt gelohnt hat, muss sich der Leser selbst beantworten.
So offen das offene Ende aber auch sein mag – die zentralen Fragen der Erzählung werden immer noch beantwortet. Wenn es also darum geht, ob Lieschen abnimmt oder nicht, dann gibt es in unserem Beispiel ein klares Ergebnis: Ja, Lieschen nimmt ab. Sonst käme sich der Leser doch betrogen vor. Somit ist auch ein offenes Ende immer noch ein Ende, nur dass es beim Beantworten der zentralen Fragen neue Fragen aufwirft.
Sinnvoll ist so ein offenes Ende aber nicht nur, wenn man den Leser zum Nachdenken bringen will, sondern auch als Appetitmacher für eine Fortsetzung:
- So könnte Lieschens Kampf gegen den Corona-Speck eine ganze Serie werden, ein Lockdown pro Band. Und in jedem Lockdown probiert sie neue Maßnahmen aus und meistert somit neue Herausforderungen.
Ansonsten kann die Ungewissheit eines offenen Endes auch gruselig wirken, beispielsweise in Das Schweigen der Lämmer:
- Zwar besiegt Clarice den Serienmörder „Buffalo Bill“, aber einem anderen – noch schlimmeren – Serienmörder ist die Flucht gelungen.
Zu guter Letzt möchte ich auch anmerken, dass all diese Kategorien keineswegs in Stein gemeißelt sind. Es soll Dich nichts davon abhalten, die Typen zu mischen, beispielsweise wenn eine Erzählung mehrere Stränge hat und das Ende in Bezug auf einige davon offener ist als in Bezug auf andere.
Epiloge
Zu besprechen ist bei diesem Thema natürlich aber auch der Epilog:
Er ist das Gegenteil des Prologs, also ein „Nachwort“ bzw. ein Kapitel nach dem letzten Kapitel, und ergänzt, was es nach dem Ende der eigentlichen Geschichte noch zu sagen gibt.
Mit anderen Worten:
- Wenn es nach der Beantwortung der zentralen Fragen am eigentlichen Ende der Geschichte noch offene sekundäre Fragen gibt, können sie hier beantwortet werden.
- Auch kann ein Epilog abschließende Gedanken des Erzählers, einer Figur oder gar des Autors enthalten.
- Oder aber der Epilog weist in die Zukunft und gibt einen Ausblick auf die Fortsetzung, den nächsten Band der Reihe.
- Und so weiter und so fort …
Generell gelten beim Epilog auch dieselben Richtlinien wie beim Prolog. Damit spreche ich vor allem über die Relevanz eines Epilogs. Denn:
Wenn er gestrichen werden kann, ohne dass die Geschichte etwas verliert, dann sollte er eben gestrichen werden.
Nicht jede Geschichte braucht einen Epilog und daher sollte er nur eingebaut werden, wenn Du seine Funktion konkret benennen kannst:
-
- In Harry Potter zum Beispiel ist der Epilog sehr berechtigt, denn nach sieben Wälzern wollen die Leser natürlich wissen, was aus den Figuren, die sie über Jahre hinweg begleitet haben, geworden ist.
- Auch könnte man, wenn es zur Geschichte passen würde, die vielen Enden des Herrn der Ringe nach der Zerstörung des Einen Rings in einem verhältnismäßig kurzen, knackigen Epilog zusammenfassen. (Die Betonung liegt dabei aber auf „könnte“, „wenn“ und „würde“ – denn zu dieser Geschichte würde es eigentlich nicht passen, aber ihr endloses Ende ist ja legendär. 😉 )
- Manche Epiloge schaffen es auch, das eigentliche Ende etwas auf den Kopf zu stellen. So endet Remarques verhältnismäßig heiterer Roman Der schwarze Obelisk mit dem Aufbruch des Protagonisten in ein neues Leben. Im 26. Kapitel jedoch, das faktisch ein Epilog ist, wird zusammengefasst, wie es den anderen Figuren erging – und es stellt sich heraus, dass die eher unsympathischen Figuren den Zweiten Weltkrieg gut überstanden haben, die sympathischen hingegen ihr Leben oder ihre Gesundheit in Konzentrationslagern, an der Front oder bei Bombenangriffen verloren. Außerdem wurde der Schauplatz des Romans, die fiktive Stadt Werdenbrück, komplett zerstört. Damit wird das positive Ende der eigentlichen Geschichte massiv gedämpft.
Das waren natürlich nur drei Beispiele, denn Epiloge sind so vielfältig wie die Geschichten, zu denen sie gehören. Auch wenn man abgesehen von der Relevanz noch sagen kann, dass Epiloge nicht zu lang sein sollten und sich oft von der eigentlichen Geschichte abheben – sei es durch eine andere Perspektive, eine andere Zeit, einen zusammenfassenden Zeitungsartikel statt einer Szene oder was auch immer –, kommt es letztendlich darauf an, was für Deine konkrete Geschichte das Richtige ist. Deswegen will ich Dir nichts vorschreiben und überlasse Dich an dieser Stelle lieber Deiner Kreativität.
Schlusswort
So viel also zu Enden. Und am Ende dieses Artikels möchte ich noch kurz erwähnen, dass wir etwas Ähnliches wie die vielen Enden bei Lieschens Kampf gegen den Corona-Speck im Steady-Livestream vom 13.02.2022 durchgespielt haben. Bloß ging es da um ganze Geschichtenkonzepte bzw. Plotverläufe, die aus einer einzigen Idee entstehen können. Wenn diese Spielerei Dich interessiert und Du mich finanziell unterstützen möchtest, bist Du in der Steady-Community herzlich willkommen.