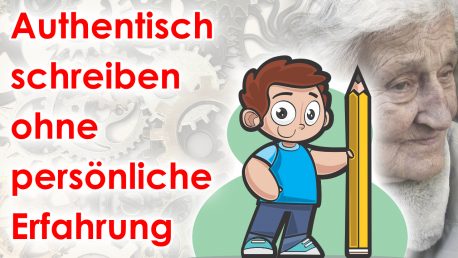Wir Autoren erschaffen gerne unbekannte Welten oder wagen uns anderweitig an Dinge, mit denen wir keine Erfahrung haben. Doch dann kommt die ernüchternde Erkenntnis, dass wir ziemlichen Unsinn fabriziert haben, der womöglich sogar diskriminierend ist. Wie können wir den Mangel an persönlicher Erfahrung also umgehen und eine sensible, authentische Darstellung erreichen? Hier einige Anregungen dazu …
Die Folien für dieses Video gibt es für Steady-Abonnenten und Kanalmitglieder auf YouTube als PDF zum Download.
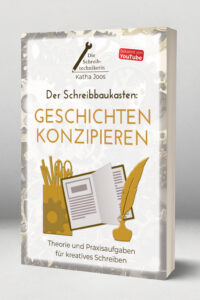 Dieser Artikel wurde zusammen mit acht weiteren Texten als Kapitel in den Schreibratgeber Der Schreibbaukasten: Geschichten konzipieren. Theorie und Praxisaufgaben für kreatives Schreiben aufgenommen, aufgefrischt und um Praxisaufgaben ergänzt. Mehr Informationen dazu gibt es hier. Und hier kannst Du das Buch direkt bei Amazon bestellen.
Dieser Artikel wurde zusammen mit acht weiteren Texten als Kapitel in den Schreibratgeber Der Schreibbaukasten: Geschichten konzipieren. Theorie und Praxisaufgaben für kreatives Schreiben aufgenommen, aufgefrischt und um Praxisaufgaben ergänzt. Mehr Informationen dazu gibt es hier. Und hier kannst Du das Buch direkt bei Amazon bestellen.
Es ist immer wieder ein Fall fürs Fremdschämen: wenn Männer über Frauen und vor allem über deren Sexualität schreiben. Das heißt natürlich nicht, dass alle Männer immer Peinlichkeiten oder gar Sexismus produzieren, wenn sie über weibliche Figuren schreiben, aber dieser Fall kommt dann doch leider etwas zu häufig vor.
Was wir dabei allerdings nicht aus den Augen verlieren sollten, ist, dass auch weibliche Autoren beim Schreiben über männliche Figuren oft spektakulär scheitern und zum Beispiel reihenweise klischeehaft feminine Sensibelchen oder – umgekehrt – stereotype, „toxisch männliche“ Möchtegern-Machos fabrizieren. Und unabhängig vom Geschlecht des Autors wird es häufig amüsant, wenn Jungfrauen Sexszenen schreiben mit bombastisch übertriebenen Orgasmen, Missachtung der menschlichen Anatomie und so weiter.
Um unfreiwillige Komik oder eine Beleidigung bestimmter Gruppen zu vermeiden, hört man oft den Ratschlag: „Write what you know.“ – „Schreibe über das, was Du kennst.“ Doch seien wir ehrlich:
Wenn jeder nur über das schreiben würde, was er kennt, dann gäbe es deutlich weniger Vielfalt und Kreativität.
Außerdem gehört es zum Schreiben ja oft dazu, dass man sich eben in eine fremde Situation, ungewöhnliche Perspektiven oder in komplett andere Welten versetzt.
Als Autoren wollen wir uns mit allem auseinandersetzen, was uns umgibt, und auch darüber hinaus. Wir wollen andere Menschen, andere Gruppen oder sogar andere Lebensformen verstehen. Wir wollen über Orte schreiben, an denen wir nie gewesen sind, oder auch komplett ausgedachte Settings realistisch gestalten. Und nicht zuletzt wollen auch Menschen, die irgendwie „anders“ sind, trotzdem über eine „Norm“ schreiben können, mit der sich die Leser identifizieren können:
Zum Beispiel wollen blinde Autoren ja nicht ausschließlich über blinde Figuren schreiben. Aber wer sein ganzes Leben lang vollständig blind gewesen ist, weiß eben nicht aus eigener Erfahrung, wie es ist, mit seinen Augen Farben wahrzunehmen.
Ich persönlich finde daher:
An „Write what you know“ ist zwar sehr viel dran, aber man sollte es auch nicht übertreiben.
Inwiefern „Write what you know“ berechtigt ist und wie wir trotzdem über unseren eigenen Tellerrand hinaus schreiben können, besprechen wir in diesem Artikel.
Der Sinn von „Write what you know“
Im Vorwort von Schreiben in Cafés schreibt die amerikanische Schriftstellerin, Dichterin und Schreiblehrerin Natalie Goldberg:
„Schreiben zu üben heißt auch, sich mit seinem ganzen Leben auseinander zu setzen.“
Und seien wir ehrlich: Ob wir es wollen oder nicht, ob wir den Autor für tot erklären oder nicht, – alles, was uns im Leben zustößt, was wir sehen und hören, am eigenen Körper spüren, durchmachen, – das alles hat einen Einfluss auf unser Schreiben. Wir Autoren können nicht anders, als bewusst oder unbewusst aus unserem Leben zu schöpfen, unsere Erfahrungen zu verarbeiten, unseren Problemen gegenüberzutreten.
Somit ist das Schreiben auch immer eine Selbstäußerung. Es ist ein Akt der Kommunikation, in dem der Autor etwas von sich an den Leser weitergibt. Und je ehrlicher er dabei ist, desto authentischer und somit ergreifender ist die Erzählung. Auch wenn die Geschichte in einer Fantasiewelt spielt, fühlt sich der Kern, das Emotionale, Spirituelle, echt an.
Und es sind vor allem solche ehrlichen – emotional ehrlichen – Geschichten, die sich ins Gedächtnis einprägen und dem Leser wirklich etwas fürs Leben mitgeben.
Zum Beispiel spielt Der Herr der Ringe bekanntermaßen in einer anderen Welt, aber auch dort machen die Figuren schwere Zeiten durch und müssen selbst in den dunkelsten Stunden Hoffnung schöpfen. Da der Autor Tolkien im Ersten Weltkrieg mitgekämpft hatte, wusste er sehr genau, worüber er da schrieb. Gleichzeitig sind diese Erlebnisse im emotionalen Sinn universell, da jeder Mensch auf die ein oder andere Weise schwere Zeiten und dunkle Stunden erlebt und die Herr-der-Ringe-Bücher somit zu einem empathischen Gesprächspartner werden.
Somit kann grundsätzlich jeder Autor zumindest emotional etwas aus eigener Erfahrung beisteuern, indem er zum Beispiel reale gesellschaftliche Ängste anspricht, praktikable Ratschläge für allgemeinmenschliche Probleme anbietet oder einfach nur Trost spendet für allgemeinmenschliche Situationen wie Liebeskummer, Verlust oder Einsamkeit.
Unabhängig davon, wo die Geschichte spielt, wo der Autor und der Leser sich geografisch befinden und wie viele Jahrhunderte zwischen ihnen liegen, findet durch die emotionale Ehrlichkeit des Autors ein tiefer zwischenmenschlicher Austausch statt.
Ehrlichkeit ist eine Herausforderung
Gleichzeitig ist „Write what you know“ auch eine Kunst für sich.
Zum Beispiel fällt auf, dass die Autoren Ernst Jünger und Erich Maria Remarque zwar beide den Ersten Weltkrieg beschreiben – in ihren Büchern In Stahlgewittern und Im Westen nichts Neues –, Jüngers Darstellung jedoch – obwohl sie auf seinen Tagebuchaufzeichnungen beruht – außerordentlich sachlich, nahezu steril wirkt, während Remarques fiktionaler Roman dagegen sehr gefühlvoll ist und damit das Grauen des Krieges besser rüberbringt.
Ich selbst kann natürlich nur spekulieren, woran das liegt, aber es gibt das Phänomen, dass Menschen, die Schlimmes erlebt haben, über ihre Traumata oft kalt und nüchtern sprechen, als wären sie jemand anderem zugestoßen. Um die Psyche des Traumatisierten zu schützen, blockt das Unterbewusstsein die schrecklichen Gefühle nämlich einfach ab. Weil das allerdings langfristig das Verarbeiten des Traumas behindert, kann diese Schutzreaktion ohne Therapie später zu psychischen Problemen und/oder psychosomatischen Erkrankungen führen. Und offenbar blockiert sie auch emotionale Ehrlichkeit bei der Weitergabe des Erlebten. – Zumindest ist es das, was ich persönlich bei Ernst Jünger vermute, der auf mich ein wenig wie ein abgebrühter, draufgängerischer Adrenalinjunkie wirkt, dem nicht bewusst ist, was da gerade psychisch mit ihm passiert und dass bestimmte Verhaltensweisen nicht mehr normal sind.
Was Remarque angeht, so hatte er im Gegensatz zu Jünger, der den Krieg fast komplett miterlebt hatte, nur eine kleine Kostprobe von einigen Wochen abbekommen. – Seinem Werk nach zu urteilen, hatten diese paar Wochen bleibende Eindrücke hinterlassen, ohne ihn jedoch emotional abzustumpfen. Deswegen mag es Remarque leichter gefallen sein, emotional ehrlich zu schreiben.
Eine andere Herangehensweise, um schwierige Erfahrungen zu verarbeiten, ist das Herumschrauben an Details. Abgesehen davon, dass man die Erlebnisse in eine vollkommen andere Welt übertragen kann, klappt es manchmal auch mit einer einfachen Verlagerung des Schauplatzes und dem künstlerischen „Zurechtstutzen“ des Erlebten:
Der russische Filmregisseur Elem Klimow wurde 1933 in Stalingrad geboren und hat dort den Zweiten Weltkrieg erlebt. 1985 erschien sein international gefeierter und preisgekrönter Film Komm und sieh: Hier schließt sich der jugendliche Protagonist im vom Nazideutschland besetzten Belarus den Partisanen an, erlebt die sadistischen Gräueltaten der Deutschen und übt zusammen mit den Partisanen brutale Vergeltung. Es ist der mit Abstand grausamste Film, den ich je gesehen habe, und ich habe eine unsägliche Angst, ihn mir jemals wieder komplett anzugucken, obwohl ich als langjährige Kriegsfilmliebhaberin sonst eher abgehärtet bin. Und das ist eine Reaktion, die ich oft auch bei anderen höre und lese: Klimow schafft es einfach, dem Zuschauer in 145 Minuten eine Art Kriegstrauma im Taschenformat zu verpassen. Als er über die Rolle seiner Kindheitserfahrungen beim Erschaffen des Films sprach, sagte er:
„Когда я был маленьким мальчиком, я был в аду … Если бы я включил все, что знал, и показал всю правду, даже я не смог бы это посмотреть.“
„Als ich ein kleiner Junge war, war ich in der Hölle … Wenn ich alles, was ich kannte, eingebracht und die ganze Wahrheit gezeigt hätte, hätte nicht einmal ich es mir anschauen können.“
Die Wahrheit – Ehrlichkeit – tut eben weh. Aber sie ist auch heilsam. Über seine Ängste, Traumata, Scham und andere Dinge zu schreiben, hat oft eine therapeutische Wirkung. Ich spreche da auch aus eigener Erfahrung: als Autor und als Leser.
Ohne persönliche Erfahrung schreiben
Nun ist das Schreiben über allgemeinmenschliche Gefühle nicht an konkrete Erlebnisse gekoppelt. Gerade dadurch können wir als Leser ja auch mit Figuren mitfühlen, die in uns völlig fremden Situationen stecken. Beim Schreiben von solchen Situationen ist es dagegen etwas schwieriger:
Denn das Erleben von konkreten Dingen verschafft uns eine Art Fachkompetenz.
Wer sich zum Beispiel noch nie etwas gebrochen hat, weiß nicht wirklich, wie sich ein Bruch anfühlt. Und wenn er es dann zu beschreiben versucht, läuft er Gefahr, irgendeinen Mist zusammenzufantasieren. Und nun stell Dir vor, es geht nicht um solche leicht korrigierbaren Dinge wie Knochenbrüche, sondern um Gruppen, denen man selbst nicht angehört. Hier sind wir schnell bei den lächerlichen bis sexistischen Darstellungen des anderen Geschlechts, diskriminierenden Darstellungen von Minderheiten, rassistischen Darstellungen von anderen Kulturen und so weiter …
Aufgrund von dieser Gefahr raten viele und auch ich selbst dazu, sich beim Schreiben auf seine Fachbereiche zu stützen und sich aus allzu unbekannten Gebieten lieber herauszuhalten. Es gibt da aber auch völlig berechtigte Einwände, zum Beispiel von Chessplayer 120:
Jetzt soll ich mich auch noch rechtfertigen, weshalb ich meinen Roman selbst schreiben will? Dass die Ideen dafür meinem kranken Kopf entsprungen sind, sollte doch als Begründung genügen. Es gibt wohl kaum einen anderen, der mein Buch nach meinen Vorstellungen schreiben kann.
Chessplayer 120: https://www.youtube.com/watch?v=0nHX172cfgw&lc=UgxLwQ1LIIX0Y9ZDdH54AaABAg.
Manchmal erfordern die Ideen in unseren „kranken Köpfen“ einfach, dass wir uns in fremde Gebiete wagen. Und manchmal wollen wir diese fremden Gebiete auch einfach verstehen und das Schreiben ist unser Mittel dazu.
Sollen wir uns also von allem fernhalten, was wir nicht aus eigener Erfahrung kennen? Natürlich nicht. Denn dann würden wir ja immer nur dasselbe schreiben. Außerdem haben wir ja unsere allgemeinmenschlichen Erfahrungen – wir alle kennen Liebe, Hass, Trauer, Freude, Ängste … – und bei der respektvollen und authentischen Darstellung von „fremden Gebieten“ geht es meistens eher um – sagen wir mal – fachliche Details: geschmackliche Noten von Leichengeruch, konkrete Situationen mit Menschen, die gar nicht merken, wie sie Dich bedrängen und einschüchtern, konkrete Gedanken angesichts einer schweren Diagnose, typische kleine Missetaten von Haustieren, um Aufmerksamkeit zu bekommen, dieses Gefühl von einer gewissen Leichtigkeit und gleichzeitigen Schwere, wenn man mit dem Flugzeug vom Boden abhebt, das Erwachen des eigenen inneren Raubtiers, wenn man irgendetwas jagt …
Es sind diese feinen, kleinen Details, die eine Erzählung realistisch und lebendig machen.
Wie lernen wir sie also kennen?
Ähnliche eigene Erfahrungen
Zunächst können wir natürlich schauen, inwiefern diese fremden Gebiete tatsächlich fremd sind. Ich spreche da einerseits von den bereits erwähnten allgemeinmenschlichen Gefühlen: Ob man sich in unserer heutigen Welt, im Mittelalter oder auf dem Planeten Furzevick verliebt, Schmetterlinge im Bauch bleiben Schmetterlinge im Bauch. Andererseits spreche ich aber auch von sehr konkreten Dingen, die man vielleicht in abgewandelter Form kennt:
Ich zum Beispiel habe im Gegensatz zu Captain Miller aus dem Film Der Soldat James Ryan keinen Weltkrieg erlebt, aber ein wenig Händezittern kenne ich trotzdem – wenn sich die Finger stressbedingt verselbstständigen, die elektrischen Impulse der Nerven verrückt spielen und es deswegen konstant kribbelt.
Kann ich wegen dieser Erfahrung über Krieg schreiben? Bestimmt nicht. Aber ich kann ja noch weitere Erfahrungen hinzunehmen: mein „Trauma im Taschenformat“ durch Komm und sieh zum Beispiel. Man stelle sich vor, ich müsste diesen Film, vor dem ich Angst habe, tagtäglich rund um die Uhr gucken, mehrere Jahre hintereinander, und dann müssten die Eindrücke um das Hundertfache multipliziert werden, weil Filme ja immer noch schwächer wirken als die Realität. – Und schon glaube ich, zumindest entfernt nachvollziehen zu können, wie das emotionale Abstumpfen bei langandauernden traumatischen Erlebnissen funktioniert.
Wenn Du also etwas Bestimmtes beschreiben willst, schadet es nicht, in die eigene Biographie zu schauen. Denn bestimmt hast Du schon mehr erlebt, als Du Dir zutraust. Ich zum Beispiel hatte auch schon eine Gehörgangsentzündung und zwei Sehnerventzündungen, habe also eine Ahnung, wie es ist, halb blind und halb taub zu sein. Ich hatte außerdem eine Phase in meinem Leben, in der ich gerne Passwörter umgangen und versteckte Bereiche von Websites erkundet habe, kenne also ein bisschen den Ehrgeiz eines (Möchtegern-)Hackers. Das bereits kurz erwähnte Erwachen des eigenen inneren Raubtiers habe ich bei Videospielen erlebt …
Allerdings sollte man sich hier auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Denn dass man etwas auf einer rein emotionalen Ebene „entfernt nachvollziehen“ kann, bedeutet nicht, dass man die fachlichen Details richtig hinbekommt. Man läuft sogar Gefahr, etwas von seiner eigenen Situation auf eine völlig andere zu projizieren und dadurch jedes noch so kleine Potential für Authentizität im Keim zu ersticken: Denn wenn Du durch Deine eigenen Erfahrungen das Gefühl von Schmetterlingen im Bauch beschreiben kannst, kannst Du lediglich nur das Gefühl von Schmetterlingen im Bauch beschreiben – das Drumherum, zum Beispiel die völlig andere Welt- und Menschenwahrnehmung im 18. Jahrhundert, ist und bleibt eine fremde Welt für Dich.
Empathie
Beim Schreiben geht es häufig eben nicht nur darum, die eigenen Erfahrungen irgendwie zu verarbeiten, sondern sich auch in andere Menschen hineinzuversetzen. Es geht also um Empathie. Und das ist viel schwieriger, als man sich oft vorstellt.
Zum Beispiel haben die beiden Forscherinnen Belén López-Pérez und Ellie L. Wilson in einer Studie herausgefunden bzw. frühere Beobachtungen bestätigt, dass Eltern das Wohlbefinden ihrer Kinder oft falsch einschätzen: Bei 10- bis 11-jährigen Kindern überschätzten die Eltern das Wohlbefinden, bei 15- bis ‑16-jährigen unterschätzten sie es. Dem liegt vermutlich ein egozentrischer bzw. Attributionsfehler zugrunde, denn die Studie fand auch heraus, dass die elterliche Einschätzung des Wohlbefindens der Kinder eher ihr eigenes Wohlbefinden spiegelte. Somit scheinen Eltern, die doch glauben, ihre Kinder genau zu kennen, ihren eigenen Gefühlszustand auf ihre Sprösslinge zu projizieren. Und wenn schon Eltern ihre Kinder nicht so gut kennen, wie sie glauben, – was soll man da von der menschlichen Fähigkeit, sich in völlig fremde Menschen hineinzuversetzen, sagen?
Das Thema Empathie habe ich bereits in einem Schreibvlog angesprochen und kann nur wiederholen, was ich dort schon ausführlicher durchgekaut habe:
Um jemand anderen zu verstehen, muss man ein wenig in seinen Schuhen laufen. Und um die Schuhe von jemand anderem anzuziehen, muss man vorher seine eigenen ausziehen.
Und das bedeutet unter Umständen, sich vorübergehend von seiner Weltwahrnehmung, seinen Begriffen und seinen Moralvorstellungen zu verabschieden. Das tut natürlich weh und die Bereitschaft dazu ist oft wenig ausgeprägt. Es hat schon einen Grund, wieso wir mit Angehörigen unserer eigenen Gruppe in der Regel deutlich mehr Empathie haben als mit Angehörigen anderer Gruppen: Bei Menschen, die ähnliche Schuhe tragen wie wir, müssen wir uns nicht allzu sehr umstellen.
Der erste Schritt zu richtiger Empathie wäre somit die Einsicht, dass man eine ahnungslose Dumpfbacke ist. Dass nichts, was man in seinem Leben je gelernt hat, wirklich wahr ist. Dass man in seiner eigenen, kleinen Welt lebt. Und dass die schlimmsten Missetäter auch in ihrer Welt leben und ihr scheinbar noch so absurdes und amoralisches Verhalten darin sehr viel Sinn macht und rational und human ist. Während Du mit all Deiner scheinbaren Moral aus ihrer Perspektive eine tiefschwarze Ausgeburt des Bösen bist.
Hör also auf zu urteilen. Das rigide Festhalten an eigenen Moralvorstellungen behindert Empathie.
(„Richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werdet“, soll ein gewisser Jeschua ben Josef mal gesagt haben.)
Was Empathie hingegen fördert, ist das Beobachten, Zuhören und Ernstnehmen. Wenn Du Deinen Gegenüber bzw. jemanden aus einer anderen Gruppe verstehen willst, musst Du seine Welt kennenlernen. Siehe dazu übrigens auch meinen Vlog über interkulturelle Kommunikation, weil die Stadien der Annäherung zwischen Kulturen im Grunde dieselben sind wie die der Annäherung bei jeder anderen Art von einander widersprechenden Gruppen. Speziell zum Zuhören bzw. Recherchieren und Auswerten von Primärquellen geht es aber hier weiter …
Primärquellen: Erfahrungen und Diskussionen
Die heutige Welt ist voll von Erzählungen aus erster Hand. Auch wenn Du selbst vielleicht niemanden kennst, auf den die Sache, über die Du schreiben willst, zutrifft, so kannst Du trotzdem auf ein breites Spektrum von Quellen zugreifen: angefangen mit autobiografischer Sachliteratur bis hin zu Diskussionen in Internetforen und in den sozialen Medien.
Natürlich ist dabei aber nicht zu vergessen, dass Menschen in der Regel nur eine Froschperspektive haben und manchmal sogar lügen. Deswegen ist es wichtig, dass Du viele Quellen konsumierst und miteinander vergleichst. Und dazu am besten auch wissenschaftliche Erkenntnisse recherchierst. Doch dazu kommen wir ein bisschen später.
Bei allem Hinterfragen solltest Du aber nicht aus den Augen verlieren, dass es bei diesem Schritt nicht darum geht, eine „objektive Wahrheit“ herauszufinden, sondern eben die zahlreichen Froschperspektiven kennenzulernen. Die Weltwahrnehmung dieser Menschen und deren Zustandekommen zu verstehen. Und das geht nur durch das Halten der eigenen Klappe und Zuhören bzw. Lesen.
Zum Beispiel wurde ich bei all den Anfragen zu diesem Thema besonders oft um Tipps für das Schreiben über Frauen bzw. Mädchen oder auch ganz allgemein über das jeweils andere Geschlecht gebeten. Und das ist bei den gesellschaftlichen Diskussionen der letzten Jahre auch nicht verwunderlich. Ich kann da natürlich keine Schritt-für-Schritt-Anleitung liefern:
Alle Menschen sind unterschiedlich und Biografien sind individuell.
Aber als zumindest ersten Schritt für die speziell weibliche Perspektive kann ich zum Beispiel ein Video von The Authentic Observer empfehlen, in dem sie auf Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen erklärt, wie Feminismus es Mädchen erschwert, Grenzen zu setzen. Als zweiten Schritt könntest Du ähnliche und widersprechende Erlebnisberichte von Frauen recherchieren, um die verschiedenen Wahrnehmungen, aber auch ihre Gemeinsamkeiten besser kennenzulernen. Anschließend machst Du dasselbe mit Hardcore-Feministinnen und Vertretern von Männerbewegungen wie Red Pill, Incels und so weiter, um aus der „Bubble“ etwas auszubrechen. Du musst dabei keiner dieser Parteien zustimmen (Um Himmels willen!), aber Du solltest sie kennenlernen, um nachzuvollziehen, mit welchen Weltbildern man als Frau oder Mädchen konfrontiert wird.
Was diese Recherchen Dir allerdings nur bedingt bieten können, ist das Nachfühlen. Denn die Erlebnisse gehören ja immer noch anderen. Da können tatsächlich künstlerische Darstellungen helfen, denn sie sind ja gerade darauf ausgerichtet, beim Rezipienten Gefühle zu wecken. Was Frauen und Mädchen zum Beispiel angeht, so habe ich bereits in meinem Vlog über Empathie den Film Promising Young Woman empfohlen: Zwar ist der Plot an sich keine typische Alltagsgeschichte, aber er bringt so einige Alltagsgefühle von Frauen sehr gut rüber.
Gleichzeitig ist bei fiktionalen Quellen aber auch besondere Vorsicht geboten – gerade weil sie emotional so stark wirken. Achte deswegen darauf, wer der Künstler ist und ob er das Dargestellte tatsächlich aus eigener Erfahrung kennt. Achte auf das Zielpublikum. Achte auf die Rückmeldungen der Rezipienten: Wer lobt und kritisiert was und warum? Mit anderen Worten: Prüfe, inwiefern die künstlerische Darstellung realistisch ist. Und das sogar bei Banalitäten. Denn jemand, der das Beschriebene tatsächlich schon mal erlebt hat, wird die Fehler definitiv bemerken. So zum Beispiel Ernst Jünger in seinen Stahlgewittern:
„Die Landschaft strahlt in der Nacht eine eigentümliche Kälte aus; diese Kälte ist von geistiger Art. So beginnt man zu frösteln, wenn man einen der unbesetzten Abschnitte des Grabens durchquert, die nur durch Streifen beschritten werden; und dieses Frösteln steigert sich, wenn man jenseits des Drahtverhaues das Niemandsland betritt, zu einem leichten, zähneklappernden Unwohlsein. Die Art, in der die Romanschreiber das Zähneklappern verwenden, ist meist verfehlt; es hat nichts Gewaltsames, sondern gleicht vielmehr einem schwachen elektrischen Strom. Oft merkt man es ebensowenig, wie man merkt, daß man im Schlafe spricht. Übrigens hört es sofort auf, wenn wirklich etwas passiert.“
Ernst Jünger: In Stahlgewittern, Kapitel: Douchy und Monchy.
Sekundärquellen für Gefühle
Doch so wichtig das emotionale Kennenlernen der zu beschreibenden Gruppe auch ist – ich wiederhole: Primärquellen sind und bleiben subjektive Froschperspektiven und die Beteiligten wissen auch selbst nicht immer, was da mit ihnen passiert. Wie bereits festgestellt, ist Remarques Im Westen nichts Neues in emotionaler Hinsicht eine deutlich bessere Quelle als Jüngers In Stahlgewittern, obwohl Letzterer deutlich mehr Zeit an der Front verbracht hat.
Wie hat Remarque es also geschafft, trotz geringer eigener Erfahrung so authentisch über den Krieg zu schreiben? – Nun, abgesehen von seiner zwar spärlichen, aber doch Erfahrung hat er sehr viel mit anderen und wesentlich erfahreneren Kriegsteilnehmern gesprochen. So gesehen hat Remarque für alle, die wissen wollen, wie sich Krieg „anfühlt“, massive Vorarbeit geleistet: Er hat Erzählungen gesammelt und auf ihrer Grundlage eine fiktionale, aber trotzdem authentische Darstellung konstruiert. Wenn wir also „Gefühle recherchieren“, ist Remarque durchaus eine wertvolle Sekundärquelle.
Bei diesem Stichwort denken wir meistens jedoch eher an wissenschaftliche Fachliteratur – und ja, auch sie sollte recherchiert werden. Wissenschaftliche Texte sind zugegebenermaßen oft schwer zu verstehen und setzen einiges an Vorwissen voraus. Aber wenn Du über eine bestimmte Gruppe schreiben willst, dann gehe ich davon aus, dass das Thema Dich interessiert. Und dieses Interesse kann Dir durchaus helfen, Dich durch sperriges Fachchinesisch zu kämpfen: Also Augen zu und durch!
Allerdings ist natürlich auch bei wissenschaftlicher Literatur Vorsicht geboten: Denn Wissenschaft ist in ständigem Wandel und was heute als allgemeiner Konsens gilt, könnte schon morgen widerlegt sein. Achte also darauf, dass Du auf dem aktuellen Forschungsstand bist, und vermeide es, wissenschaftliche Erkenntnisse als in Stein gemeißelt zu betrachten. Es kann immer noch passieren, dass schon morgen glaubhaft nachgewiesen wird, dass wir in einer Matrix leben, die erst gestern von Aliens erschaffen wurde.
Außerdem lassen sich der Wissenschaft oft auch eine gewisse Empathielosigkeit und Hochnäsigkeit attestieren, die wiederum den Erkenntnisgewinn behindern:
So wird heutzutage zum Beispiel zu Recht der leider immer noch verbreitete Ansatz kritisiert, dass Forscher über Autisten sprechen statt mit Autisten. Dabei sind viele von ihnen nach wie vor der Meinung, Autisten hätten keine Empathie. Dass das Unterstellen von Empathielosigkeit gegenüber jemandem, in dessen Innenleben man keinen Einblick hat, eher von der eigenen Empathielosigkeit spricht, scheint ihnen nicht aufzufallen. Kreise, die mit Autisten arbeiten, kommen hingegen zu dem Schluss, dass Autisten durchaus Empathie empfinden und das Problem eher im Scheitern der Kommunikation zwischen Autisten und Nichtautisten liegt: Autisten verhalten sich oft scheinbar unempathisch, weil sie den emotionalen Zustand ihres Gegenüber einfach kognitiv nicht erkennen. Wenn man ihnen diesen Zustand auf eine ihnen verständliche Weise erklärt, fühlen sie aber intensiv mit, laut einigen Stimmen sogar intensiver als Nichtautisten. Und gleichzeitig besteht das Problem auch umgekehrt: Nichtautisten sind meistens kognitiv nicht in der Lage, den emotionalen Zustand von Autisten zu erkennen. Wer hat es also schwerer: neurotypische Menschen, die mit einem scheinbar unempathischen Autisten zu tun haben, oder ein Autist, der sein Leben lang fast ausschließlich oder zumindest überwiegend von Menschen umgeben ist, die ihm keine Empathie entgegenbringen?
Aus diesem Grund halte ich es für wichtig, wissenschaftliche Quellen nur als Ergänzung zu sehen. Denn speziell beim Thema Autismus empfinde ich den YouTube-Kanal Galoxee’s Asperger TV als deutlich bessere Sekundärquelle: Die Macherin selbst, Doro, ist zwar neurotypisch, aber ihr Mann und ihre beiden Kinder sind Asperger-Autisten, sie hat mit ihnen tagtäglich zu tun und kennt daher beide Welten hervorragend. Dadurch kann sie auf verständliche Weise Nichtautisten über Autismus aufklären und Autisten über Nichtautisten.
Das ist aber natürlich auch bei anderen Themen zu beachten. Wissenschaft kann zum Beispiel höchstens psychologische Grundprinzipien erklären, beleuchtet aber nicht „von innen heraus“, was wirklich in depressiven oder gar suizidgefährdeten Menschen vorgeht. Menschen, die regelmäßig mit Betroffenen arbeiten, wissen da eher Bescheid und haben einen individuelleren Zugang. Zwar analysiert die Wissenschaft Fälle aus der Praxis, aber sie versucht auch, zu verallgemeinern und Tendenzen zu erkennen, um sie dann in nüchternen, emotionslosen Wörtern zusammenzufassen. Die Leute „vor Ort“ arbeiten eher mit konkreten Menschen und konkreten Geschichten. Und wenn man genug konkrete Geschichten kennenlernt, bekommt man irgendwann durchaus auch selbst ein Fingerspitzengefühl dafür, was realistisch ist und was nicht. Man trainiert es sich quasi an.
Sekundärquellen für Fakten
Natürlich sollte aber nicht nur bei Gefühlen recherchiert werden. Im Gegenteil: Meistens denkt man bei Recherchen eher an Fakten, Sachinformationen. Und da stehen Dir – je nach Art der gesuchten Informationen – unendlich viele Möglichkeiten offen:
- Allem voran wären da natürlich Google und andere Suchmaschinen (auch für Recherchen zu emotionalen Themen geeignet). Wenn Du da besonders raffiniert bist, kannst Du auch sogenannte Operatoren nutzen, um Deine Suchergebnisse zu präzisieren. Eine Liste dieser Befehle findest Du hier.
- Bei Orten, an denen Du selbst noch nie gewesen bist, kannst Du neben Reiseberichten und Reiseführern auch auf Tools wie Google Earth zurückgreifen: Hier findest Du zum Beispiel exakte Straßenverläufe, Fotos und teilweise sogar dreidimensionale Darstellungen der Gebäude.
- Bei historischen Fragen gibt es neben Fachliteratur auch die Möglichkeit von Museen. Ich zum Beispiel bin eine begeisterte Museumsgängerin und weiß mittlerweile aus Erfahrung, dass ein noch so bedrohlich inszenierter Panzer auf der Leinwand nichts ist im Vergleich zu einem echten Panzer, der sich bewegt, riesige Wolken stinkender Abgase produziert und seine Kanone auf Dich richtet. Auch wenn Du weißt, dass es nur noch ein harmloses Exponat ist, eine Art großes Spielzeug, nichts weiter, spürst Du körperlich, dass Du, wenn Du so einem Viech in der „freien Wildbahn“ begegnen würdest, ratzfatz die Hosen voll hättest. Buchstäblich.
- Speziell bei historischen Settings bietet sich auch die zeitgenössische Literatur der jeweiligen Epoche an: Hier kannst Du sehen, wie die Menschen ihre Welt und ihre Zeit wahrgenommen haben, welche Werte sie hatten, wie sie gesprochen haben, wie ihr Alltag aussah und wie sie miteinander interagiert haben. Kombiniere das am besten aber mit historiographischer Fachliteratur, damit Du definitiv verstehst, was Du da liest.
- Bei Fantasy- und Science-Fiction-Settings kommt es natürlich darauf an, wo Du Deine Inspiration hernimmst. Denn meistens lehnen wir Ausgedachtes dann doch an die Realität an. Recherchiere also die Themengebiete, die Dich inspirieren! Sei gleichzeitig aber auch generell offen gegenüber neuen Informationen und eigne Dir eine gute Allgemeinbildung an: Denn wenn Du realistische Welten erschaffen willst – also Welten, die sich echt anfühlen –, solltest Du eine Vorstellung davon haben, wie die reale Welt funktioniert und wie alles zusammenhängt. In der Regel sind fiktive Welten nämlich nur Spielarten der realen Welt, bloß mit magischen, technologischen oder anderweitigen Modifikationen. Du solltest die reale Welt gut genug kennen, um einschätzen zu können, wie die reale Welt mit diesen Modifikationen funktionieren würde. Denn sonst wird Deine fiktive Welt schnell unglaubwürdig. Wobei aber genau das auch Deine Absicht sein könnte, wie zum Beispiel im Fall von Alice im Wunderland. Wenn es also das ist, was Du willst, dann lass Deiner Fantasie freien Lauf!
Literarische Bearbeitung ist immer eine Verfälschung!
Bei aller Faktenrecherche sollten wir jedoch nicht einmal den Gedanken zulassen, wir könnten die Realität exakt abbilden. Mehr noch, ich halte eine exakte Abbildung nicht einmal für sinnvoll. Denn erinnern wir uns daran, was die grundlegende Natur des Erzählens ausmacht:
Erzählen ist immer ein Filtervorgang und damit immer eine Verfälschung der „Realität“.
Das wird auch dann wichtig, wenn man tatsächlich über eigene Erfahrungen schreibt. So wurde ich zum Beispiel gefragt, wie man über die Emotionen eines Kindes schreiben soll, das noch keine Worte dafür hat. Und ich glaube, man kann diese Frage beantworten, wenn man sich noch schwierigere Perspektiven anschaut, nämlich Erzählungen aus der Sicht von Tieren oder sogar Gegenständen: Sie haben nicht nur überhaupt keine Worte, sondern auch eine völlig andere Wahrnehmung bzw. überhaupt keine Wahrnehmung. Die Art und Weise, wie eine Katze die Welt wahrnimmt, ist zwar sehr interessant und es ist spannend, sich das vorzustellen, aber es ist keine Perspektive, der man als Mensch über einen längeren Zeitraum folgen kann, ohne sich auf einem komplett fremden, unverständlichen Planeten zu fühlen. Denn es ist eine Wahrnehmung und eine Perspektive, die komplett anderen Prinzipien folgt. Der Rezipient einer Erzählung braucht aber in der Regel etwas, an dem er sich „festhalten“ kann, um sich in der Geschichte zurechtzufinden: einen Anker, etwas Vertrautes, etwas, das für sein menschliches Hirn Sinn ergibt. Aus diesem guten Grund werden Perspektiven von Tieren und Gegenständen meistens vermenschlicht. Es wird zwar durch spezifische Details ein gewisser Flair erzeugt, indem die Reflektorfigur schnurrt, sich mit der Zunge putzt und ihren Menschen als übergroße Wärmeflasche wertschätzt, aber diese Details sind in der Regel äußerlich und werden auf emotionaler und gedanklicher Ebene in ein dem menschlichen Zielpublikum verständliches Paradigma eingeordnet.
Übertragen auf die Problematik der kindlichen Perspektive bedeutet das, dass man sich fragen sollte, worauf es einem selbst eigentlich ankommt. Man kann natürlich versuchen, die Erzählung eins zu eins so zu verfassen, wie ein Kind es formulieren würde. Aber erstens ist das sehr schwierig, weil wir da massiv Gedächtnisakrobatik betreiben müssen, und zweitens geht es doch eher darum, bei den Rezipienten eine bestimmte emotionale Reaktion zu erzeugen, und dazu möchte man auch auf raffiniertere Techniken, zum Beispiel auf bestimmte Stilmittel, zugreifen. Deswegen wird – ähnlich wie beim Beispiel mit der Katze – meistens ein Mittelweg beschritten: Man benutzt durchaus Sprache und rhetorische Kniffe, die man eher später im Leben lernt, aber man tarnt das Ganze hinter einer kindlichen Stilisierung: spezifische kindliche Wörter und Ausdrucksweisen, spezifische kindliche Interpretationen und Gedankengänge und so weiter.
Diese emotionale und rhetorische Stilisierung ist es meiner Meinung nach auch, was Remarques Darstellung des Ersten Weltkrieges ergreifender macht als die Jüngers. Zwar habe ich vorhin vermutet, dass es an Remarques besserem Zugang zu seinen eigenen Gefühlen liegt, aber das ist nur die Substanz. Denn wenn man diese Substanz, die entsprechenden Gefühle, genau versteht und es ertragen kann, sie wieder zu fühlen, dann findet man auch am ehesten die passenden verbalen Ausdrücke dafür. Und diese Ausdrücke sind es, die die Gefühle beim Leser auslösen, auch wenn sie in der Realität nicht passen: Ein Soldat, der sich unter Artilleriebeschuss an die Erde drückt, denkt in der Realität zum Beispiel eher ans Überleben (wenn er denn überhaupt denkt und nicht seinem Instinkt folgt). Bei Remarque hingegen gibt es einen emotional und rhetorisch aufgeladenen Abschnitt darüber, was die Erde für einen Soldaten bedeutet. Es ist also eine Verfälschung der Realität, die die realen Gefühle aber deutlicher rüberbringt. Ebenso wie Poesie beim Rezipienten Gefühle auslöst, obwohl die Gedichtform im Alltag eher unnatürlich ist.
Schlusswort
Nun hast Du also ein paar Tipps, wie Du an fehlender persönlicher Erfahrung vorbeischleichen kannst. Zum Schluss möchte ich noch betonen, was ich zwischendurch immer mal wieder angedeutet habe:
Alle Ansätze ergänzen einander und gehören deswegen kombiniert.
Wenn Du zum Beispiel über eine Stadt schreibst, in der Du noch nie gewesen bist, kannst Du Dich zusätzlich zu den Reiseführern und Reiseberichten auch auf Deine eigenen Erfahrungen in einer ähnlichen Stadt stützen. Dazu solltest Du idealerweise natürlich überprüfen bzw. nachrecherchieren, ob die Städte tatsächlich vergleichbar sind.
Ansonsten möchte ich ganz besonders bei diesem Thema mein ständiges Mantra von Testlesern wiederholen: Besonders im Fall von sensiblen Themen solltest Du unter anderem nach Testlesern suchen, die von der jeweiligen Sache betroffen sind. Denn wer kann Unstimmigkeiten besser ausfindig machen als sie?
Und was schließlich das Handwerkliche angeht, also das konkrete Beschreiben mit Worten und Stilmitteln, so verweise ich auf meine bereits erschienenen Artikel über das Beschreiben allgemein und das Beschreiben von Emotionen und Gefühlen.