Manche Autoren plotten ihre Geschichten im Voraus, andere entdecken sie erst mitten im Schreibprozess. Die meisten sind irgendwo dazwischen. Alle Ansätze haben ihre Vor- und Nachteile und man sollte seinen Typ kennen, um bewusst von seinen Stärken profitieren zu können. Möge dieser Artikel ein Orientierungspunkt für Dich sein!
Die Folien für dieses Video gibt es für Steady-Abonnenten und Kanalmitglieder auf YouTube als PDF zum Download.
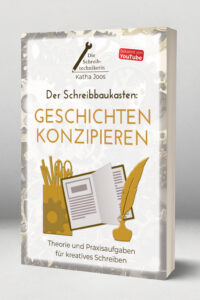 Dieser Artikel wurde zusammen mit acht weiteren Texten als Kapitel in den Schreibratgeber Der Schreibbaukasten: Geschichten konzipieren. Theorie und Praxisaufgaben für kreatives Schreiben aufgenommen, aufgefrischt und um Praxisaufgaben ergänzt. Mehr Informationen dazu gibt es hier. Und hier kannst Du das Buch direkt bei Amazon bestellen.
Dieser Artikel wurde zusammen mit acht weiteren Texten als Kapitel in den Schreibratgeber Der Schreibbaukasten: Geschichten konzipieren. Theorie und Praxisaufgaben für kreatives Schreiben aufgenommen, aufgefrischt und um Praxisaufgaben ergänzt. Mehr Informationen dazu gibt es hier. Und hier kannst Du das Buch direkt bei Amazon bestellen.
Wenn es um den Schreibprozess geht, scheint es zwei Typen von Autoren zu geben: Plotter und Pantser. Das heißt: Autoren, die die Handlung durchplanen, bevor mit dem Schreiben anfangen, und Autoren, die die Geschichte erst während des Schreibens „entdecken“.
Beide Typen haben ihre Vor- und Nachteile und sind außerdem auch keine Typen, sondern vielmehr zwei Enden eines Spektrums.
Deswegen ist es manchmal auch schwer, sich selbst richtig einzuordnen: Die meisten von uns haben von beidem etwas. Dabei ist es durchaus wichtig, seinen „Typ“ und dementsprechend auch seine Bedürfnisse beim Schreiben zu kennen:
Denn diese „Grundkonfiguration“ eines Autors beeinflusst, welche Probleme man beim Schreiben hat, wie man sie überwindet und wie man mit Schreibtipps umgehen sollte.
Deswegen sprechen wir in diesem Artikel über Plotter und Pantser und wie man das Beste aus seinem „Typ“ macht.
Das Spektrum
Beginnen wir mit einer Beschreibung der beiden Typen, die ja, wie bereits erwähnt, eigentlich nur die beiden Extrempunkte auf einer Skala sind. Das heißt:
Ja, es gibt eindeutige Plotter und Pantser, aber die meisten Autoren dürften Mischwesen sein.
Erwarte deswegen nicht, Dich in einem der beiden Typen komplett wiederzuerkennen. Vielmehr geht es darum, in welche Richtung man mehr tendiert.
Plotter
Der Begriff „Plotter“ kommt – wer hätte das gedacht? – vom Wort „Plot“ und bedeutet somit, dass jemand beim Erschaffen einer Geschichte von der Handlung ausgeht bzw. dass die Handlung bereits feststeht, wenn der Plotter zu schreiben anfängt.
Soll heißen: Der idealtypische Plotter plant jedes noch so kleine Detail einer Geschichte im Voraus. Handlung, Twists, Andeutungen, Symbole, Metaphern, was auch immer. Das ist auch bitter nötig, denn ohne einen festen Plan im Kopf – oder in den Stichpunkten in seinen Notizen – kann er einfach nicht schreiben. Er muss immer genau wissen, was er gerade zu Papier bringt und warum.
Die Geschichte im Kopf des Plotters ist – wenn er ein guter Autor ist – bereits ausgereift und er braucht sie „nur noch“ niederzuschreiben. Damit weiß der Plotter eigentlich immer, was er gerade zu schreiben hat, und bleibt nicht ratlos an irgendwelchen Szenen oder Sätzen hängen und ist weniger anfällig für Schreibblockaden.
Der Nachteil ist, dass mit einem festen Plan eine geringere Flexibilität einhergeht. Wenn ein Detail auf halbem Weg geändert werden muss, dann muss auch gleich der komplette Plan entsprechend angepasst werden. Auch läuft ein Plotter eher Gefahr, dass die Figuren vor allem „mechanisch“ dem Plot dienen und ihre Emotionen sich beim Lesen etwas „starr“ bzw. „roboterhaft“ anfühlen. Dass die Gefühle und das Verhalten einer Figur also nicht organisch aus der Szene heraus entstehen, sondern weil die Figur auf eine bestimmte Weise fühlen, denken und handeln muss, damit der Plot funktioniert.
Pantser
Der Begriff „Pantser“ kommt von der englischen Redewendung „to fly by the seat of one’s pants“, die so viel bedeutet wie: „aus dem Bauch(gefühl) heraus handeln“. Eine alternative Bezeichnung ist discovery writer, also Entdeckungsautor. Gemeint ist also ein Autor, der ohne Plan, aus dem Bauch heraus zu schreiben anfängt, und die Geschichte erst während des Schreibens entdeckt.
Soll heißen: Da gibt es einen Funken von Inspiration, der den Autor „juckt“, ein Satz vielleicht, eine Szene, eine Figur … Und der Autor setzt sich hin, beginnt zu schreiben und schaut, was dabei herauskommt. Nach Plan schreiben wie der Plotter kann er nicht, denn wenn der Pantser weiß, wie die Geschichte weitergeht, verliert er schnell das Interesse am Schreiben. Oder er schmeißt den Plan ständig um, sodass es keinen Sinn macht, überhaupt erst einen zu machen.
Wenn der Pantser seine Visionen gut in Worte fassen kann, lesen sich seine Geschichten tendenziell sehr „lebendig“. Die Gefühle, Gedanken und Handlungen der Figuren entstehen ganz organisch aus der Szene heraus und die Gefühle des Autors, der „Funke von Inspiration“, sind im Text sehr spürbar.
Der Nachteil ist, dass man sich ohne Plan schnell verirrt oder in eine Sackgasse manövriert. Es kann also passieren, dass der Pantser irgendwann vor seinem Text sitzt und keine Ahnung hat, wie es weitergehen soll. Schlimmstenfalls macht keine seiner Ideen Sinn und/oder er merkt, dass seine Geschichte nur noch ein einziges, verheddertes Chaos ist. Und sollte er sein Manuskript doch noch beenden, muss mit größter Wahrscheinlichkeit sehr viel überarbeitet werden, damit die Geschichte ein kohärentes Ganzes bildet.
Zwischenformen und Selbsteinschätzung
So viel zu den Extremformen. Doch die meisten Autoren liegen, wie gesagt, irgendwo dazwischen. Der exakte Mittelpunkt wäre, wenn man als Autor mit einer Vorstellung vom Gesamtplot zu schreiben anfängt, aber nicht viel konkret plant.
Wie findet man also heraus, ob man nun Plotter oder Pantser ist? Vor allem, wenn man eben gewissermaßen beides macht, aber nichts von beidem in Extremform?
Ich wiederhole mich, aber: Es kommt wirklich vor allem darauf an, welche Seite überwiegt. Doch das ist oft schwer einzuschätzen, weil man teilweise nicht weiß, wie man all seine einzelnen Verhaltensweisen beim Schreiben gewichten soll. Unter Umständen führt das sogar zur völligen Fehleinschätzung. So habe ich mich zum Beispiel lange Zeit eher für einen Plotter gehalten, bin mittlerweile aber sicher, dass ich ein Pantser bin.
Damit Du Dich nicht in Deiner Selbsteinschätzung verirrst, empfehle ich, möglichst nur auf das Grundlegendste zu schauen:
Hast Du einen Plan und wie gehst Du damit um? Hältst Du ihn im Großen und Ganzen ein oder siehst Du ihn nur als grobe Richtlinie bzw. eine vorläufige Idee?
- Wie detailliert planst Du Deine Geschichten? Arbeitest Du Details und Kausalverhältnisse heraus (eher Plotter) oder hast Du einfach nur Szenen im Kopf, die irgendwann im späteren Verlauf irgendwie passieren sollen (eher Pantser)?
- Hältst Du dich mehr oder weniger streng an Deinen Plan (eher Plotter) oder schmeißt Du ihn auf halbem Weg gerne um und/oder änderst sogar das Ende ins Gegenteil (eher Pantser)?
- Bist Du misstrauisch gegenüber spontanen Ideen (eher Plotter) oder bindest Du sie ein, selbst wenn sie die Geschichte in eine völlig andere Richtung lenken (eher Pantser)?
- Und so weiter und so fort …
Auch kannst Du beobachten, wie „fruchtbar“ Deine aktuelle Herangehensweise ist:
- Wenn Du oft vor einem leeren Blatt oder Word-Dokument sitzt und nicht weißt, was Du schreiben sollst, könntest Du vielleicht probieren zu planen. Denn das kann ein Hinweis sein, dass Du eben kein Pantser bist, sondern ein Plotter.
- Wenn Du vor dem Schreiben ausführlich plottest, danach aber, wenn Du Worte zu Papier bringen willst, plötzlich „die Luft raus ist“, obwohl Du genau weißt, was Du schreiben willst, dann bist du vermutlich kein Plotter, sondern ein Pantser. Vielleicht hilft es ja, wenn Du Deinen Plan weniger detailliert machst und den Rest erst beim Schreiben entdeckst?
Bitte verwechsle Deinen Typ auch nicht mit banaler Disziplinlosigkeit. Wenn Du immer nur auf Deine „Muse“, auf den „Funken von Inspiration“, wartest, ist es kein Wunder, wenn Du schlecht vorankommst. Gerade Pantser tappen in diese Falle, aber da die meisten Autoren ja Mischwesen sind, sind auch die Plotter nicht komplett davor sicher: Die meisten von uns kennen das, wenn wir uns zum Schreiben hinsetzen, aber etwas uns einfach blockiert. Ich habe schon länger über einen Artikel über Schreibblockaden nachgedacht, wo ich ein paar Tipps teilen würde, wie man dagegen ankämpfen kann. Daher hebe ich mir dieses Thema für nächstes Jahr auf und begnüge mich an dieser Stelle mit dem wohl wichtigsten Tipp:
Setze Dich auf Deine vier Buchstaben und schreib. Egal, ob es gut wird oder nicht. Überarbeiten kannst Du später immer noch. Hauptsache, am Ende der Schreibsession steht da was. Sei es auch nur ein einziger Absatz. Solange Du irgendetwas geschrieben hast, sei stolz auf Dich und mach Dir auf keinen Fall Vorwürfe, es sei zu wenig.
Modell von Ellen Brock: 4 Typen
Eine regelrechte Offenbarung und entscheidende Hilfe bei der Selbsteinschätzung war für mich das Modell von Ellen Brock, einer US-amerikanischen Lektorin und YouTuberin. Sie unterscheidet zwischen vier Typen von Autoren, da sie neben Plottern und Pantsern noch ein zweites Spektrum einführt: die Opposition von intuitivem und methodologischem Schreiben.
- Autoren mit einer extremen intuitiven Ausprägung plotten und überarbeiten ihre Manuskripte „nach Gefühl“. Sie denken also eher emotional statt logisch und fühlen sich durch Theorien, Modelle, Strukturen etc. eher eingeschränkt.
- Autoren mit einer extrem methodologischen Ausprägung hingegen halten sehr viel von Theorien, Modellen, Strukturen etc., sie kennen sie, wenden sie gerne an und empfinden sie als hilfreich. Sie denken also vor allem logisch und strategisch und wenn sie versuchen, etwas intuitiv zu machen, dann kommen eher fade, ziellose Geschichten bei heraus.
Wie auch bei Plottern und Pantsern ist der Übergang zwischen diesen beiden Extremen fließend. Und in Kombination mit den Plottern und Pantsern ergeben sich die bereits angekündigten vier Typen.
Intuitiver Pantser
Die Extremform des intuitiven Pantsers ist die Verkörperung des romantisierten Schriftsteller-Klischees: Er hat keinen Plan, aber dafür kreative, originelle Ideen und weiß im Grunde nicht, was er tut, macht intuitiv aber alles richtig. Er setzt sich einfach hin, schreibt nach Gefühl, und das Ergebnis ist stimmig und solide.
Ellen findet, dass die meisten Autoren intuitive Pantser sein wollen, aber die wenigsten es wirklich sind. Ihrer Meinung nach ist das der seltenste Typ, weil man dafür schon eine Art Wunderkind sein muss.
Das bedeutet, dass Du mit großer Wahrscheinlichkeit kein intuitiver Pantser bist und nicht einfach „frei nach Schnauze“ schreiben solltest. Das ist aber natürlich nicht ausgeschlossen, denn Menschen, die so schreiben können, gibt es tatsächlich. Nur sind das sehr wenige.
Außerdem gilt: Nur weil intuitive Pantser intuitiv und ohne Plan vieles richtig machen, heißt das nicht, dass ihre Erstentwürfe nicht korrigiert gehören. Im Gegenteil, Manuskripte von intuitiven Pantsern brauchen oft sehr viele Korrekturen. Diese machen die intuitiven Pantser aber auch nach Gefühl, d. h. nicht, weil die Geschichte laut Modell XY dieses oder jenes Element braucht, sondern weil ihre Intuition ihnen sagt, dass sie dieses oder jenes einbauen oder ändern sollten.
Intuitiver Plotter
Der idealtypische intuitive Plotter plant zwar alles im Voraus, tut es aber nicht anhand von bestimmten Handlungsstukturen und Modellen, sondern nach Gefühl. Er hat einfach eine bestimmte Geschichte in seinem Kopf und/oder in seinen Notizen, kümmert sich aber eher wenig um Theorie und gestaltet die Geschichte so, wie es sich für ihn „richtig“ anfühlt.
Das bedeutet: Wenn Du allein nach Gefühl Dich oft nicht mit Dir selbst darauf einigen kannst, wie Deine Geschichte zu verlaufen hat, wenn Du also rein intuitiv meistens keine Lösungen findest, bist Du vermutlich kein intuitiver, sondern ein methodologischer Plotter.
Methodologischer Plotter
Beim idealtypischen methodologischen Plotter ist alles extrem strukturiert und komplett durchgeplant. Jede Szene folgt einer bestimmten Struktur, die Interaktionen der Figuren folgen einem festen Schema von Aktion und Reaktion, jede Figurenentwicklung ist genau durchgeplant und insgesamt hangelt sich dieser Autor an einer Handlungsstruktur seiner Wahl entlang.
Ellen meint, dass der methodologische Plotter sein Manuskript mehr oder weniger im Voraus überarbeitet. Er bastelt aus all seinen Ideen ein in sich stimmiges und durchdachtes Gefüge, das auf nachweislich funktionierenden Strukturen und Modellen basiert. Deswegen sind später beim Überarbeiten nur wenige Änderungen nötig und wenn der methodologische Plotter ein System gefunden hat, das bei ihm selbst gut funktioniert, kann er dieses System immer wieder auf neue Bücher anwenden und dadurch schneller schreiben als andere Typen.
Methodologischer Pantser
Der methodologische Pantser mag sich wie ein Widerspruch in sich anfühlen, denn dieser Autor kombiniert spontanes Entdecken der Geschichte mit Theorien, Modellen, Strukturen etc., aber es ist tatsächlich möglich: Ja, der methodologische Pantser plant nur bedingt im Voraus, hat aber bestimmte Strukturen im Kopf, in die er seine Ideen einordnet.
In der Praxis ist der Schreibprozess eines methodologischen Pantsers ein ständiger Wechsel von Planen, Schreiben und Überarbeiten: Er plant ein bisschen, dann schreibt er ein bisschen, dann plant er noch ein bisschen mehr, dann schreibt er ein bisschen weiter, dann plant er weiter und merkt, dass etwas methodologisch nicht mehr passt, und überarbeitet einen früheren Abschnitt, schreibt dann weiter, plant noch etwas, schreibt, überarbeitet … Kurzum: alle Stadien des Buchschreibens gleichzeitig.
Einordnen und berühmte Beispiele
So viel zu den vier Typen. Für eine bessere und ausführlichere Erklärung empfehle ich – wie immer – die ursprüngliche Quelle, nämlich Ellen Brocks Video zu dem Thema. Zum Schluss aber noch ein paar Worte zur Selbsteinordnung und der Versuch einer Einordnung zweier bekannter Autoren:
Weil es sich bei dem Modell eher um Quadranten um zwei Achsen herum handelt, können die Ausprägungen ganz unterschiedlich ausfallen. Der eine mag ein extremer Plotter sein, aber auf der Intuitiv-methodologisch-Achse irgendwo in der Mitte liegen. Der andere ist vielleicht ein extremer methodologischer Pantser. Der Nächste hat nur eine leichte Tendenz zum Pantsertum und einen leichten intuitiven Einschlag. Autoren sind individuell und die vier Typen dienen einfach der Orientierung.
Ich selbst habe mich im methodologischen Pantser wiedererkannt. Dass ich methodologisch veranlagt bin, dürfte bei diesem Blog ja auch unbestreitbar sein. Das heißt aber nicht, dass ich mich sklavisch an alle Modelle halte, die ich hier predige, sondern ich schaue, was zu meiner Geschichte passt, und wenn ein Modell nicht mehr passt, werfe ich es über Bord und wähle ein anderes.
Die Frage nach Plotter oder Pantser hingegen konnte ich mir erst durch Ellens Modell eindeutig beantworten und dass ich mich früher eher für einen Plotter gehalten habe, liegt wohl an meiner methodologischen Natur. Und wenn man den methodologischen Aspekt weglässt, bin ich tatsächlich eher ein Pantser: Ich bringe Figuren um, die ursprünglich überleben sollten, ich schreibe am liebsten aus dem Bauch heraus, auch wenn ich mir Ziele setze, wo das Ganze hingehen soll, bin offen für spontane Ideen, die oft besser sind als das, was ich ursprünglich im Kopf hatte, und ich schreibe im Schneckentempo, weil ich ständig zwischen Planen, Schreiben und Überarbeiten switche. Erst letztens habe ich in meinem aktuellen Projekt, das zu drei Vierteln geschrieben ist, mal eben die Hautfarbe einer Figur geändert. Ich hatte zwar eine Phase, in der ich sehr genau geplottet habe, aber in dieser Zeit konnte ich nur Kurzgeschichten schreiben. Und ich konnte einfach nicht verstehen, warum ich nichts Längeres auf die Reihe bekommen habe. Jetzt weiß ich, was das Problem war: Ich habe viel zu detailliert geplottet und in all den Details die Essenz des Ganzen aus den Augen verloren.
Ich habe jetzt von mir selbst erzählt, weil ich von meinem eigenen Schreibprozess wohl am meisten Ahnung habe. Ich kann nicht in die Köpfe anderer Autoren schauen oder sie Tag und Nacht stalken, um genau zu verstehen, welchem Typ sie angehören. Ich kann höchstens anhand von Büchern und Interviews spekulieren:
- So vermute ich, dass J. K. Rowling ein intuitiver Plotter ist. Laut Interviews hat sie immer eine allgemeine Gliederung des Plots und wusste von Anfang an, dass es sieben Harry Potter-Bände geben würde. Ich wüsste aber nicht, dass sie bewusst theoretische Modelle anwenden würde, und sie scheint Dinge wie die vielen Vaterfiguren von Harry erst im Nachhinein bemerkt zu haben. Sie entscheidet einige Dinge eben erst beim Schreiben und ich vermute, dass damit die intuitive Komponente gemeint ist.
„I always have a basic plot outline, but I like to leave some things to be decided while I write.“
- George R. R. Martin unterstelle ich, ein methodologischer Pantser zu sein. Er selbst unterteilt Autoren in Architekten und Gärtner, wobei Architekten im Voraus planen und somit den Plottern entsprechen und Gärtner im Grunde wissen, welche Art von Samen sie in die Erde stecken, aber keine Ahnung haben, wie viele Äste die Pflanze haben wird. Er selbst sieht sich als Gärtner, also Pantser. Das merkt man nicht zuletzt auch daran, dass Das Lied von Eis und Feuer mit einer einzigen Szene in seinem Kopf begann und schließlich in ein Mammutwerk ausgeartet ist, das er bis an den heutigen Tag nicht beendet hat. Allerdings schreibt er nicht einfach wild drauflos, sondern scheint durchaus bewusst bestimmten Regeln zu folgen, die Motive sehr stimmig weiterzuentwickeln und Andeutungen für zukünftige Plot-Twists äußerst absichtlich zu streuen. Weil ich selbst ein methodologischer Pantser bin und sehr langsam schreibe, maße ich mir an, nachvollziehen zu können, warum er sich mit dem nächsten Band der Eis und Feuer-Saga so viel Zeit lässt: Vermutlich hat er eben nicht alles haarklein durchgeplant, muss aber all die Handlungslinien jonglieren und sicherstellen, dass alles passt, und die Erwartungen der weltweiten Leserschaft machen das Ganze nicht wirklich einfacher, denn dadurch muss alles umso mehr passen.
„I think there are two types of writers, the architects and the gardeners. The architects plan everything ahead of time, like an architect building a house. They know how many rooms are going to be in the house, what kind of roof they’re going to have, where the wires are going to run, what kind of plumbing there’s going to be. They have the whole thing designed and blueprinted out before they even nail the first board up. The gardeners dig a hole, drop in a seed and water it. They kind of know what seed it is, they know if they planted a fantasy seed or mystery seed or whatever. But as the plant comes up and they water it, they don’t know how many branches it’s going to have, they find out as it grows. And I’m much more a gardener than an architect.“
Tipps für die unterschiedlichen Neigungen
Vereinfachende, verallgemeinernde Modelle wie die Opposition von Plottern und Pantsern oder die Erweiterung von Ellen Brock können nun aber so hilfreich wie verwirrend sein. Hilfreich, weil sie einen Überblick verschaffen. Verwirrend, weil die meisten Autoren ja irgendwo in der Mitte liegen. Die meisten arbeiten nun mal ein bisschen mit Intuition und ein bisschen mit irgendwelchen „Regeln“, die meisten haben eine Vorstellung, in welche Richtung die Geschichte geht, machen unterwegs jedoch interessante Entdeckungen.
Die spezifischen Probleme, die man beim Schreiben hat, liegen also in der individuellen Mischung eines jeden Autors begründet und daher müssten die Lösungsansätze für diese Probleme ebenfalls individuelle Mischungen sein.
Das ist auch ein Grund, warum Schreibtipps sich oft widersprechen und es immer am Autor selbst liegt, die Tipps auszuwählen, denen er folgen möchte.
Zu Schreibregeln und zur Auswahl der passenden Schreibtipps habe ich bereits einen eigenständigen Artikel und ich möchte ihn Dir an dieser Stelle unbedingt ans Herz legen. Denn wenn ich jetzt darüber rede, was ich persönlich Autoren mit den verschiedenen Tendenzen empfehlen würde, ist es Deine Aufgabe zu entscheiden, welcher Tipp in welchem Ausmaß zu Dir passt.
Stärken nutzen
Bei meinen Gedanken, wie man den Nachteilen der verschiedenen Neigungen entgegenwirken kann, gehe ich davon aus, dass man seinen Typ wahrscheinlich nicht ändern kann.
Wenn wir auf die Welt kommen, ist unser Gehirn auf eine bestimmte Weise vorprogrammiert und wir funktionieren am besten, wenn wir diese Grundprogrammierung anerkennen und bestimmungsgemäß nutzen.
Ja, oft würde man gerne von den Vorteilen eines anderen Typs profitieren. Doch wenn wir unsere eigene Natur vergewaltigen, um diesem anderen Typ zu entsprechen, kann ich mir einfach kein gutes Ergebnis vorstellen. Und wenn man meint, mit seinem Typ keine guten Ergebnisse zu erzielen, dann vermute ich entweder eine falsche Nutzung der eigenen Grundkonfiguration oder eine falsche Typzuordnung (wie bei mir selbst, als ich sehr detailliert geplottet habe und nichts Längeres hervorbringen konnte).
Beobachte also Dich selbst, probiere herum und vielleicht hilft ja der ein oder andere der folgenden Tipps, Deine individuellen Stolpersteine zu überwinden. Es sind, wie gesagt, nur meine eigenen Überlegungen, entstanden nach dem Prinzip: Wenn ich meine Natur nicht ändern kann – Wie kann ich dann meine Stärken nutzen, um meine Schwächen auszubügeln?
Tipps für Plotter
Wenn der Plotter Gefahr läuft, etwas „starre“ Geschichten hervorzubringen, dann liegt das vermutlich daran, dass er ein ziemlicher Kopfmensch ist. Und wenn Du die Handlung gut planen kannst, dann solltest Du auch Dinge wie Emotionen gut planen können, wenn Du genug Wissen darüber hast.
Deswegen ist meine Empfehlung für Plotter eine verstärkte Lektüre zu psychologischen Themen und von Erlebnisberichten, damit die Emotionen und Handlungen authentisch wirken.
Als Pantser, der auch ein bisschen im Voraus plant, passiert es mir hin und wieder, dass ich erst beim Schreiben einer Szene merke, dass die Entscheidung, die eine Figur fällen sollte, eigentlich nicht passt, oder dass eine andere Entscheidung einfach passender und/oder interessanter wäre. Als Pantser habe ich eben erst, wenn ich „mittendrin“ stecke, wirklich etwas wie einen Überblick, was eine Figur denkt und fühlt. Als Plotter müsstest Du aber in der Lage sein, diesen Überblick schon im Voraus zu haben. Dazu müsstest Du als Kopfmensch aber vor allem einen guten Überblick über die psychologischen Prinzipien haben, wie Menschen denken und wie sie ihre Entscheidungen fällen. Je besser Deine Kenntnis dieser Thematik ist, desto realistischer und authentischer handeln Deine Figuren.
Tipps für Pantser
Wenn der Pantser zwar viele spontane Ideen hat, sich aber schnell darin verheddert, in Sackgassen landet oder sogar eine Schreibblockade erlebt, dann sehe ich die Lösung nicht im Plotten, sondern im Ankurbeln der kreativen Intuition. Die Geschichten, die der Pantser niederschreibt, kommen in Wirklichkeit nämlich nicht aus dem Bauch, nicht von Gott und auch nicht aus dem Universum. Vielmehr entstehen sie aus den Strukturen und Gesetzmäßigkeiten, die der Autor im Laufe seines Lebens verinnerlicht hat und die nun in seinem Unterbewusstsein sitzen, sich vermischen und verknoten und in Form von Geschichten an die Oberfläche dringen: Der Pantser bringt somit das hervor, was er unterbewusst gelernt hat.
Wenn Du als Pantser also Auswege aus Sackgassen suchst oder nicht weißt, wie es weitergehen soll, liegt das vermutlich daran, dass Dein Unterbewusstsein noch keine Lösungen für diese Situationen gelernt hat.
Daher wäre mein Tipp an dieser Stelle, das Unterbewusstsein, Dein Bauchgefühl, zu füttern: Jeder Autor sollte viel lesen und anderweitig Geschichten konsumieren, ja, aber Pantser sollten es meiner Meinung nach umso mehr tun. Denn sie können sich nicht bewusst auf vorgefertigte Handlungsstrukturen stützen. Deswegen sollte ihr Unterbewusstsein möglichst viele verschiedene Geschichten kennen, um etwas Neues und Einzigartiges daraus zu basteln.
Auch sollten Pantser stärker als Plotter auf ihre Schreibdisziplin achten und Mittel und Wege nutzen, um besser in den Schreibfluss zu kommen. Gemeint sind beispielsweise bestimmte Rituale, ein bestimmter Soundtrack und so weiter. Ausführlichere Tipps dazu folgen in dem Artikel über Schreibblockaden.
Tipps für Intuitive
Ähnlich wie beim Pantser geht es beim intuitiven Typ um eine Art unterbewusstes Wissen. Deswegen auch hier:
Besonders viel lesen.
Durch Lektüre guter Bücher prägen sich funktionierende Techniken im Unterbewusstsein ein und können intuitiv angewandt werden. Die Kenntnis theoretischer Modelle schadet zwar nicht, wenn man sich grundsätzlich dafür interessiert. Aber als intuitiver Typ wirst Du die Modelle wahrscheinlich nicht anwenden können. Und wenn Du kein Interesse an ihnen hast, solltest Du sie Dir auch nicht aufzwingen.
Tipps für Methodologische
Als methodologischer Typ profitierst Du am meisten vom Analysieren der Werke anderer, um die darin verwendeten Techniken selbst zu nutzen. In Deinem Fall macht es also Sinn,
gezielt Werke mit einer interessanten und/oder ungewöhnlichen Struktur zu lesen, neue Modelle kennenzulernen und Dich mit „richtigen“ literaturwissenschaftlichen Analysen zu befassen, so sperrig geschrieben sie auch sein mögen.
Denn Du läufst Gefahr, „stupide“ immer wieder dieselben Strukturen anzuwenden. Das kann zwar ein Vorteil sein, weil Du so schneller schreibst als andere und/oder später weniger überarbeiten musst, aber womöglich leidet die Originalität. Du solltest Deine Liebe für Strukturen und Modelle, Deine nahezu wissenschaftliche Herangehensweise, also nutzen, um die große, weite Welt der unbegrenzten Möglichkeiten besser kennenzulernen.


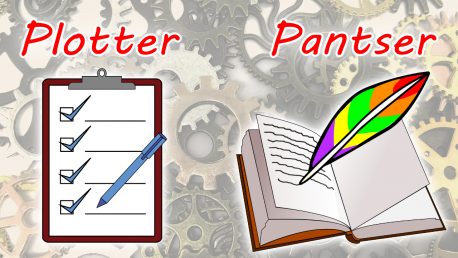
Hey,
bei den Tipps für Methodologische schreibst du: „und Dich mit „richtigen“ literaturwissenschaftlichen Analysen zu befassen“
Hättest du ein konkretes Beispiel für solch eine Analyse?
Mein persönlicher Favorit wäre ja: Puškins Prosa in poetischer Lektüre: Die Erzählungen Belkins von Wolf Schmid. Aber Du kannst auch recherchieren, was es für literaturwissenschaftliche Beiträge zu Deinen Lieblingswerken gibt. Dazu könntest Du zum Beispiel auf die Website einer Universitätsbibliothek Deiner Wahl gehen und dort die Suche nutzen, um Sekundärliteratur speziell zu diesen Lieblingswerken zu finden.