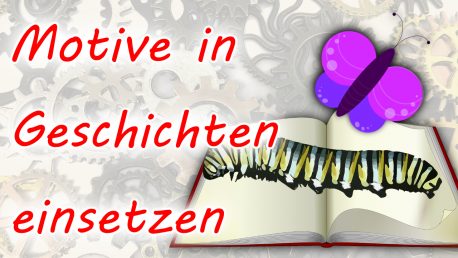Motive machen eine Erzählung vielschichtiger. Doch was sind sie überhaupt und wie funktionieren sie? Wie setzen wir sie in unseren eigenen Geschichten ein? Was müssen wir beachten? – Darüber sprechen wir in diesem Artikel.
Die Folien für dieses Video gibt es für Steady-Abonnenten und Kanalmitglieder auf YouTube als PDF zum Download.
Motive. – Das sind diese geheimnisvollen, scheinbar ungreifbaren Elemente, die angeblich den künstlerischen Wert einer Geschichte steigern. Doch was sind Motive überhaupt? Wie erkennt man sie und wie baut man sie in eigene Werke ein? Und wozu genau existieren sie? – Das schauen wir uns heute an!
Definition
Unter einem Motiv versteht man ein wiederkehrendes Element, das das Thema einer Geschichte stützt. Normalerweise taucht es im Verlauf der ganzen Geschichte auf, in der Regel dreimal oder öfter. Dabei kann es sich auch verändern und somit die Zustandsveränderung in der Geschichte veranschaulichen.
Was bedeutet das also?
Bestimmt ist Dir aufgefallen, dass es in Geschichten immer wieder etwas gibt, das sich wiederholt. Es kann ein Gegenstand sein, der immer wieder auftaucht, ein bestimmtes Wort oder ein Spruch, den die Figuren ständig machen, eine bestimmte Farbe, die sich penetrant durch das ganze Setting zieht, ein Geräusch, eine Handlung der Figuren …
Weil ein Motiv alles Mögliche sein kann, ist es vielleicht etwas schwierig zu definieren. Aber wenn man mit offenen Augen durch die Welt des Storytellings geht, bemerkt man zum Beispiel,
dass in Dostojewskis Verbrechen und Strafe bzw. Schuld und Sühne die Farbe Gelb sehr präsent ist: Die Tapeten in den Wohnungen sind gelb, die Möbel sind gelb, die Gesichter der Figuren sind gelb … In diesem Roman beschreibt Dostojewski sehr detailliert die Armut im St. Petersburg des 19. Jahrhunderts und das Gelb ist hier von eher kränklicher Natur und repräsentiert Armut, Verfall und Leid. Damit trägt es zur deprimierenden Gesamtstimmung des Romans bei.
Ein optimistischeres Beispiel ist der Sittich in der Liebesgeschichte Toradora!, der als Running Gag fungiert: Inko schafft es einfach nicht, ihren Namen auszusprechen, dafür aber völlig andere Wörter, die viel komplizierter sind. Erst am Ende, als die beiden Hauptfiguren endlich ein Paar werden, kriegt Inko ihren Namen auf die Reihe. Somit spiegelt Inkos Fähigkeit, ihren Namen auszusprechen, den Beziehungsstatus der beiden Hauptfiguren.
Wie Du bei beiden Beispielen sehen kannst, existiert die Wiederholung nicht einfach so, sondern ist, wie es sich für ein Motiv eben gehört, an das zentrale Thema gekoppelt, nämlich Armut bzw. Liebe. Während die Farbe Gelb bei Dostojewski jedoch vor allem der Atmosphäre und dem World-Building dient, sprich: der realistischen Darstellung der katastrophalen Lebensverhältnisse der Figuren, hat die Entwicklung des Motivs in Toradora! vor allem eine emotionale Wirkung, da sie subtil die Freude für die beiden Hauptfiguren verstärkt.
Mit anderen Worten:
Motive machen eine Erzählung vielschichtiger.
Es wird nicht nur stupide heruntergerattert, was passiert, sondern das zentrale Thema und seine Entwicklung werden auch auf anderen Ebenen sicht- und spürbar.
Kulturelle Motive
Natürlich existieren Motive aber nicht nur innerhalb ihres jeweiligen Werks, sondern gerne auch kulturübergreifend. Und Du kennst sie: Das sind Elemente, die in verschiedenen Geschichten immer wieder auftauchen, beispielsweise der Doppelgänger, das Liebesdreieck, zwei Brüder als Rivalen, wobei einer den anderen auch noch umbringt …
Und ja, wir bewegen uns hier im Bereich der Archetypen und Klischees. Diese sind nicht zwangsläufig Motive, weil sie nicht immer „aufgeladen“ sind bzw. mit dem zentralen Thema einer Geschichte zu tun haben; aber weil Motive ja alles Mögliche sein können, sind auch Archetypen und Klischees keine Ausnahme.
Sagen wir es mal so:
Wenn Dein Protagonist einer anderen Figur begegnet, die ihm sehr ähnlich sieht, es aber keine weitere Bedeutung hat, dann ist das kein Motiv. Wenn der Doppelgänger allerdings eine zentrale – und meistens dunkle – Eigenschaft des Protagonisten verkörpert oder das genaue Gegenteil von ihm darstellt, dann sollte man hellhörig werden.
Oder: Wenn irgendwo im Hintergrund ein Liebesdreieck vor sich hin plätschert, dann ist das wahrscheinlich kein Motiv. Aber wenn der Protagonist sich in einem Liebesdreieck wiederfindet und es auch noch der Dreh- und Angelpunkt der Erzählung ist, dann ist das garantiert ein Motiv.
Was diese kulturellen Motive erschaffen, ist ein intertextueller Kontext. Denn Motive fungieren ähnlich wie Hashtags in den sozialen Medien: Sie verknüpfen Dinge, die zusammengehören, und erschaffen einen größeren Zusammenhang. – Gelbe Tapete ist zum Beispiel nichts weiter als gelbe Tapete, bis einem auffällt, dass die Farbe Gelb sehr oft vorkommt und mit Armut und Elend zu tun hat. Und ein Liebesdreieck ist zunächst nur ein Liebesdreieck, bis man auch noch zwanzigtausend andere Geschichten mit Liebesdreiecken gelesen hat, wobei jede idealerweise eine neue Facette darstellt, ähnlich wie wenn man unter einem einzigen Hashtag viele verschiedene Meinungen zu einem Thema antrifft.
Ob die Autoren es also beabsichtigen oder nicht, tragen sie mit den Motiven in ihren Geschichten zum kulturellen Diskurs bei.
Um mal ein Beispiel von der KreativCrew zu klauen:
Der Badboy, der sich von einem braven Mädchen „zähmen“ lässt, ist ein beliebtes Motiv. Und als solches ist es zunächst neutral. Doch wie das KreativCrew-Mitglied, das dieses Beispiel angebracht hat, meinte, kann es auch gefährlich werden: nämlich dann, wenn junge Mädchen zu viele solcher Geschichten konsumieren und sich auf missbräuchliche Beziehungen einlassen, weil sie meinen, sie könnten ihren Badboy umerziehen.
Als Autor kann man mit diesem Motiv jedoch unendlich kreativ werden: So wird im Film bzw. Musical Grease der Junge zwar zahmer, aber auch das brave Mädchen verändert sich und wird sogar zum „Badgirl“. Nun kann man, je nachdem, wie man die Geschichte interpretiert, kritisieren, dass hier propagiert wird, man solle sich für seinen Love-Interest verändern. – Was kann man also machen? Abgesehen davon, dass man solche Motive umkehren kann (braver Junge, rebellisches Mädchen), sind auch anderweitige Manipulationen möglich, zum Beispiel wenn das brave Mädchen einsieht, dass der Badboy ihr schadet und ihn verlässt. Durch das gemeinsame Motiv – Badboy und braves Mädchen – reiht sich eine solche Geschichte in den Kontext der verherrlichenden Darstellungen ein und kritisiert sie.
Abgrenzungen
Doch nicht nur zu den Archetypen und Klischees ist der Übergang fließend. Denn der Begriff selbst bringt bereits Verwechslungspotential mit sich: Während es im Englischen die Begriffe motif und motive gibt, hat das deutsche Wort „Motiv“ beide Bedeutungen. Das englische motive ist dabei das Motiv im Sinne von Beweggrund bzw. Motivation. Und über die Motivation von Figuren haben wir schon an anderer Stelle gesprochen, daher verzichte ich hier auf eine Erklärung. Das Motiv, über das wir in diesem Artikel reden, ist das englische motif.
Auch ist der Unterschied zum Thema selbst nicht immer klar – vor allem, wenn das Motiv nicht sehr abstrakt ist. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass eine Figur Selbstbewusstsein aufbauen muss und ständig jammert: „Ich kann das nicht!“ Hier ist das Selbstbewusstsein das Thema, also das, worum es geht, und das Motiv – der sich ständig wiederholende Spruch – dient nur der Unterstützung, hier indem er das Thema in eine konkrete Form bringt und das fehlende Selbstbewusstsein greifbar macht.
Besonders starke Überschneidungen gibt es mit dem Symbol. Grundsätzlich ist ein Symbol einfach nur etwas, das für etwas anderes steht, siehe meine Reihe zu rhetorischen Stilmitteln. Normalerweise ist ein Symbol auch keiner Veränderung unterworfen: Die Taube als Symbol für den Frieden bleibt ein Symbol für den Frieden, egal, wie man es dreht oder wendet. Gleichzeitig – und das ist das Schwierige – kann ein Symbol durchaus als Motiv fungieren.
Nehmen wir zum Beispiel unsere fiktive Handlung aus dem Artikel über das Entwickeln eines Plots mit der Drei-Akt-Struktur: Sagen wir mal, das Team, das die Welt retten soll, ist international und bei der Bedrohung handelt es sich um eine Alieninvasion. Als das internationale Team im ersten Akt also scheitert, weil alle zerstritten sind, dann repräsentiert das die Zerstrittenheit der Nationen unserer Welt. Und um das noch sichtbarer auszudrücken, könnte man inmitten der Zerstörung am Ende des ersten Aktes die Aufmerksamkeit auf eine tote Taube lenken: Der Frieden zwischen den Nationen unserer Welt ist tot und deswegen sind wir dem Untergang geweiht. Als das Team dann im Verlauf des zweiten Aktes seine internen Konflikte allmählich auflöst, könnte man hin und wieder das Fiepen von Taubenküken draußen vor dem Fenster des Hauptquartiers einbringen. Am Ende, als das internationale Team sich als Familie begreift und den Feind besiegt, fliegen die nun ausgewachsenen Küken über den Himmel: Die Repräsentanten verschiedener Nationen haben Empathie füreinander entwickelt und gemeinsam die Welt gerettet – es gibt eine Chance für den Weltfrieden.
Schließlich werfen auch unzeitliche Verknüpfungen Fragen nach der Abgrenzung auf. Eine unzeitliche Verknüpfung ist eine Verbindung von zwei oder mehr Elementen durch Ähnlichkeit oder Unterschied. Wir haben bereits im Artikel über die Repetitio darüber gesprochen. Und während ich nicht behaupten würde, dass die unzeitliche Verknüpfung und das Motiv dasselbe sind, halte ich es auch nicht für notwendig, eine klare Grenze zu ziehen: Denn in vielen konkreten Fällen sind sie tatsächlich dasselbe. Ein Motiv verknüpft verschiedene Stellen einer Erzählung miteinander auf unzeitliche Weise – und ist somit eine unzeitliche Verknüpfung. Bloß gilt das nicht umgekehrt:
In der Assassin’s‑Creed-Reihe zum Beispiel haben mehrere Figuren eine Narbe auf der Lippe. Sie verbindet vor allem die Protagonisten der ersten Spiele miteinander. Abgesehen von dieser bloßen Verbindung scheint die Narbe allerdings keine tiefere Bedeutung zu haben, zumal ihre Verwendung auch nicht konsequent ist. Sie ist also durchaus eine unzeitliche Verknüpfung, aber kein Motiv.
Motive einsetzen
Um also kurz zusammenzufassen:
Motive machen eine Erzählung vielschichtiger und verstärken so ihre emotionale Wirkung.
Mit anderen Worten: Motive sind fancy! Man kann sie passiv genießen – oder man kann sie auch aktiv intellektuell analysieren und in die eigene Interpretation eines Werkes einbeziehen. Deswegen werden Erzählungen, die mit Motiven arbeiten, gerne – und oft auch zu Recht – als anspruchsvoller und qualitativ hochwertiger wahrgenommen.
Von diesem Kuchen wollen wir natürlich etwas abhaben und fragen uns daher: Wie können wir selbst in unseren Werken Motive einsetzen?
Sicherlich kommt meine Sicht der Dinge von meiner Pantsernatur, wird für die Plotter also vielleicht nicht gut passen, aber
ich persönlich halte nichts davon, Motive zu erzwingen.
Denn auch wenn Motive grundsätzlich eine Erzählung aufwerten können, braucht nicht jede Geschichte Motive und kein Motiv ist besser als ein aus den Fingern gesaugtes, das dem Leser auch noch aggressiv unter die Nase gerieben wird.
Die besten – das heißt: effektivsten – Motive entstehen meinen Beobachtungen nach eher von selbst:
So hat J. K. Rowling, Interviews nach zu urteilen, nicht allzu bewusst die vielen Vaterfiguren in den Harry-Potter-Büchern erschaffen. Und anschließend ermordet. Sie selbst erzählt von einem problematischen Verhältnis zu ihrem eigenen Vater und auch wenn Sirius Black, Albus Dumbledore und Remus Lupin eher idealisierte Figuren sind, verschwinden sie nach und nach aus Harrys Leben. Doch am Ende, im Epilog, ist Harry selbst Vater und es passt zum zentralen Thema der Reihe, nämlich dem Erwachsenwerden. Auf einer tieferen Ebene geht es aber anscheinend auch um das Überwinden einer traumatischen Vergangenheit.
Das ist einer der Gründe, warum das Schreiben gerne als Seelenstriptease bezeichnet wird: Ohne dass wir es bewusst wahrnehmen, sickert unser Innenleben mitsamt all seiner Schattenseiten in unsere Werke, durchtränkt sie und so kommt es zu sich wiederholenden Elementen, die wir Autoren oft erst im Nachhinein bemerken.
Ich würde daher empfehlen, es einfach geschehen zu lassen und erst später, vielleicht mitten im Schreibprozess, zu schauen, ob man unbewusst etwas eingebaut hat. Und wenn man etwas entdeckt, kann man damit etwas bewusster weiterarbeiten und anhand der Prämisse überlegen, wie das Motiv sich entwickeln soll.
Dasselbe gilt auch, wenn man von vornherein Ideen hat, welche Motive man einbauen möchte. Denn zwar bin ich dagegen, sich etwas aus den Fingern zu saugen, aber manchmal hat man schon während des Plottens wunderschöne Einfälle. Und wenn sie als Motive funktionieren sollen, müssen sie natürlich an das zentrale Thema und damit auch an die Prämisse gekoppelt sein. – Wie das aber genau aussehen soll, musst Du Dir für Dein individuelles Werk ganz individuell überlegen.
Motive gekonnt einsetzen
Nun ist es schön und gut, Motive im Kopf herauszuarbeiten. – Doch wie sorgt man dafür, dass sie beim Leser auch bewirken, was sie sollen, dabei aber nicht nervig oder zu kompliziert werden?
Meine erste Empfehlung wäre: Entspann Dich! Wenn Deine Leser die Motive nicht bewusst wahrnehmen, ist das kein Drama. Nur ein Bruchteil aller Leser achtet tatsächlich auf solche Dinge. Deswegen, würde ich sagen, wirken Motive meistens eher auf unterbewusster Ebene: Mit dem Kopf nehmen wir Harrys Vaterfiguren vielleicht nicht wahr – oder erst, wenn jemand uns explizit darauf hinweist; aber auf der rein emotionalen Ebene trägt die Entwicklung um die Vaterfiguren dazu bei, dass wir Harrys Reifeprozess intensiver fühlen. Und wenn das funktioniert, dann ist das Motiv gelungen.
Nun kann aber natürlich auch das Gegenteil passieren, nämlich dass die Motive so explizit eingebracht werden, dass man sie einfach nicht übersehen kann. Das ist in der Regel sehr nervig, denn niemand will einen Text lesen, in dem alles schreit: „Hier, schau, ein Motiv! Und hier noch eins! Siehst Du, wie hier alles voller Motive ist? Denk nach, analysiere sie und bewundere meine überbordende Intelligenz! – Ach ja, habe ich schon erwähnt, dass mein Text voller Motive ist?“
Damit ein Motiv ein solches ist, sollte man es natürlich mindestens dreimal wiederholen. Allerdings solltest Du Deine Motive trotzdem sparsam einsetzen – d. h. nur dann, wenn die Motive tatsächlich zur jeweiligen Textstelle etwas beitragen. Wenn ein Motiv nichts beiträgt, außer ein Motiv zu sein, dann lass es an der entsprechenden Stelle lieber weg. Frage notfalls Deine Testleser, ob die Motive nicht zu penetrant sind.
Ansonsten kommt es natürlich auch darauf an, wie man die Motive verpackt. So fällt die Farbe Gelb in Verbrechen und Strafe durchaus auf, steht aber nicht im Vordergrund und tritt gerne in Kombination mit anderen Merkmalen auf: Die gelbe Tapete zum Beispiel hat vielleicht weiße Blümchen und das Gesicht der jeweiligen Figur ist nicht einfach nur gelb, sondern blässlich gelb. Oder das Motiv drängt sich durchaus in den Vordergrund, hat dabei aber eine positive Wirkung auf den Rezipienten, zum Beispiel wenn es – wie in Toradora! - als willkommener Running Gag fungiert.
Motive und Missverständnisse
Eine Gefahr, vor der Dich jedoch nichts wirklich schützen kann, sind Missverständnisse. Denn was ich bereits im Artikel über Gewalt angesprochen habe, gilt leider auch hier:
Du kannst nicht vorhersehen, was für verdrehte Flausen Deine späteren Leser in ihren Köpfen haben werden.
Ein interessantes Beispiel ist der Film Sucker Punch. Die Meinungen über ihn sind sehr gespalten und das ist einer der Werke, bei denen eingefleischte Fans argumentieren, dass Kritiker es einfach nicht verstanden haben. Natürlich glauben die Kritiker selbst, dass sie Sucker Punch verstehen, aber wenn ich mir zum Beispiel die Kritik von Doug Walker (Nostalgia Critic) ansehe, dann habe ich den Eindruck, dass er tatsächlich nur die oberste Schicht der Symbole und Motive verstanden hat, aber nicht die noch viel tieferen Bedeutungen:
Wenn er zum Beispiel Baby Doll als persönlichkeitslos kritisiert, dann würde ich gerne auf das zentrale Motiv der Träume verweisen und behaupten, dass Baby Doll keine komplexe Persönlichkeit braucht, weil sie ein ausgedachtes Alter Ego von Sweet Pea ist. Die Ebene, die Doug Walker für die Realität hält, ist überwiegend auch nur ein Traum bzw. findet im Kopf der eigentlichen Protagonistin (Sweet Pea) statt. Es geht in dem Film eben nicht um einen buchstäblichen Ausbruch aus einer Nervenheilanstalt, sondern um das Erlangen von innerer Freiheit.
Link-Empfehlungen:
- ASCseries: You Don’t Understand SUCKER PUNCH
https://youtu.be/qQm1rBqh53Y - 3G1M: In Defense Of Sucker Punch (2011)
https://youtu.be/1kZPPtT6wRY
Ich würde sagen, Sucker Punch ist ein künstlerisch höchst anspruchsvoller und emotional mitreißender Film mit sehr viel Tiefgang. Aber den vielen negativen Kritiken nach zu urteilen ist er auch komplizierter, als ihm guttut. Denn:
Es ist schwierig, Deine Botschaft an den Rezipienten zu bringen, wenn er Deine Sprache nicht versteht.
Das Problem mit der Komplexität ist, dass der Rezipient auch nicht alles bis ins kleinste Detail vorgekaut bekommen möchte. Die perfekte Balance zwischen „zu kompliziert“ und „zu einfach“ zu finden ist schwer und hängt auch stark von der jeweiligen Zielgruppe, dem Genre und dem Marketing ab. Deswegen kann ich auch keine Regeln aufzählen, mit denen man eine solche Balance auf jeden Fall hinbekommt.
Ein paar allgemeine Richtlinien möchte ich aber dennoch formulieren:
- Weil ich bezweifle, dass man eine ideale Anzahl von Motiven nennen kann, empfehle ich das Prinzip: Weniger ist mehr.
- Am besten, Du konzentrierst Dich auf die Motive, die ohnehin von alleine entstehen, und versuchst nicht, krampfhaft noch andere Motive und Symbole an den Haaren herbeizuziehen.
- Achte außerdem bei Deinen Testlesern darauf, ob sie Deine Motive wahrnehmen und wie sie sie verstehen. Und wenn es mehrheitlich zu gravierenden Missverständnissen kommt, dann passe Deine Erzählung an bzw. mache sie etwas verständlicher.
Ansonsten ist es auch kein Problem, wenn Du Deine Erzählung trotz allem so kompliziert machen möchtest wie Sucker Punch. Auch solche Werke haben eine Existenzberechtigung – ich und eine Menge anderer Zuschauer auch haben diesen Film sehr genossen und sind froh, dass er existiert. Mache Dich in einem solchen Fall aber darauf gefasst, dass Du von der Mehrheit massiv missverstanden wirst.
Schlusswort
So viel also zu Motiven. Ich hoffe, ich konnte diesen Begriff verständlich erläutern und ein paar wertvolle Tipps und Anregungen geben. Und natürlich wünsche ich Dir viel Spaß beim Hochschrauben des literarischen Anspruchs Deiner Werke!