Rhetorische Stilmittel sorgen für einen besseren Schreibstil. In diesem Artikel nehmen wir einige dieser Stilmittel, nämlich Metonymie, Synekdoche, pars pro toto und totum pro parte unter Einbeziehung von Beispielen unter die Lupe.
Die Folien für dieses Video gibt es für Steady-Abonnenten und Kanalmitglieder auf YouTube als PDF zum Download.
Die Metonymie und die Synekdoche gehören zu den sogenannten Tropen, zu denen man auch die Metapher und die Ironie zählt. Diese beiden Stilmittel wurden bereits in den beiden vorangegangenen Teilen besprochen. Mit diesem dritten Teil schließen wir das Thema der Tropen ab.
Die Metonymie
Die Metonymie ist eine „Namensvertauschung“ bzw. „Umbenennung“. Diese wörtliche Übersetzung ist jedoch etwas ungenau, denn bei der Metonymie geht es vor allem um Nachbarschaft oder Zugehörigkeit zwischen Gesagtem und Gemeintem. Die Namensvertauschung und Umbenennung erfolgt hier also keineswegs zufällig.
Die Metonymie hat zahlreiche Unterarten. Dazu gehören unter anderem:
- Ursache steht für Wirkung oder Wirkung steht für Ursache:
„Goethe lesen“, „Gesundheit trinken“ - Rohstoff steht für Erzeugnis:
„Stahl“ für Schwert, „ein Glas trinken“ - Ort (oder Epoche) steht für das, was sich dort befindet:
„Berlin entscheidet“, „abergläubisches Mittelalter“ - Besitzer steht für Besitz oder Anführer steht für Angeführte:
„der Nachbar ist abgebrannt“, „Napoleon erobert“
Unter Umständen ergibt sich bei der Metonymie ein fließender Übergang zum Symbol. Zum Beispiel, wenn man „Ruhm und Ehre“ durch „Lorbeeren“ ersetzt. Das ergibt sich historisch, weil die Überreichung eines Lorbeerkranzes früher eine Folge von Ruhm und Ehre war.
Die Synekdoche
Auch hier ist die wörtliche Bedeutung, „Mitverstehen“, etwas ungenau. Was eine Synekdoche darstellt, ist eher, dass das Gesagte aus demselben Begriffsfeld stammt wie das Gemeinte. Das heißt: Es geht hier um die Vertauschung einer engeren und weiteren Bedeutung bzw. von einem Ober- und Unterbegriff.
Einige Beispiele:
- „unter einem Dach“
- „Brot“ für Nahrungsmittel
- „Reptil“ für Krokodil
- „Nase“ für Mensch
- „Raubkatze“ für Tiger
- „der Deutsche“ für alle Deutschen
Es liegt auf der Hand, dass die Grenze zur Metonymie sehr fließend ist. Tatsächlich kann man sich in vielen Fällen streiten, ob man es mit einer Metonymie oder einer Synekdoche zu tun hat.
Pars pro toto und totum pro parte
Sie sind Sonderformen der Metonymie und Synekdoche.
 Pars pro toto bedeutet, dass ein Teil für das Ganze steht.
Pars pro toto bedeutet, dass ein Teil für das Ganze steht.
- Beispiel: Ein Kopf ist ein Teil eines Menschen.
Man sagt: „Ein Keks pro Kopf!“
Man meint: „Ein Keks pro Mensch!“
 Das Gegenteil von pars pro toto ist totum pro parte. Das heißt so viel wie: Das Ganze steht für einen Teil.
Das Gegenteil von pars pro toto ist totum pro parte. Das heißt so viel wie: Das Ganze steht für einen Teil.
- Beispiel: Ein deutscher Sportler ist ein Teil von Deutschland.
Man sagt: „Deutschland gewinnt die Weltmeisterschaft.“
Man meint: „Ein bestimmter deutscher Sportler gewinnt die Weltmeisterschaft.“
Literarisches Beispiel
„Rostow stand auf und schlenderte zwischen den Lagerfeuern umher und erging sich in Träumereien darüber, welch ein Glück es wäre zu sterben, nicht als Lebensretter des Kaisers (davon wagte er gar nicht zu träumen), sondern einfach nur vor den Augen des Kaisers. Er war tatsächlich in den Kaiser verliebt und in den Ruhm der russischen Waffen und in die Hoffnung auf den bevorstehenden Sieg und Triumph. Und er war nicht der einzige, den dieses Gefühl in jenen denkwürdigen Tagen erfüllte, die der Schlacht bei Austerlitz vorhergingen; neun Zehntel der russischen Armee waren damals, wenn auch weniger enthusiastisch als er, in ihren Zaren und in den Ruhm der russischen Waffen verliebt.“
Lev Tolstoj: Krieg und Frieden, Buch 1, Teil 3, Kapitel X.
Die „russischen Waffen“ sind im Russischen ein feststehender Ausdruck. Aber es ändert nichts daran, dass es sich hierbei um ein pars pro toto handelt: Es geht hier natürlich nicht darum, dass die Russen ganz besondere Waffen haben, sondern hier stehen die Waffen stellvertretend für die ganze Armee (und ihre obligatorische Ausrüstung).
Ob es sich bei den „russischen Waffen“ um eine Synekdoche oder um eine Metonymie handelt, ist jedoch eine Sache der Interpretation:
Einerseits könnte man sagen, es sei eine Synekdoche, denn die Waffen kann man ja als Unterkategorie des Kriegshandwerks sehen. Für eine Metonymie hingegen spricht, dass die Waffen für die Soldaten (Besitzer) stehen, aber auch für deren Kampfgeschick (Wirkung).
Hinweise zur Abgrenzung
Wenn man diese Stilmittel „in der freien Wildbahn“ antrifft, wird man sie nicht immer eindeutig zuordnen können. Wie gesagt: Die Übergänge zwischen den Stilmitteln sind oft fließend.
Ein großer Unterschied besteht jedoch zur Metapher:
Die Metapher basiert nämlich auf Ähnlichkeit.
Die Metonymie und die Synekdoche hingegen auf Zugehörigkeit.


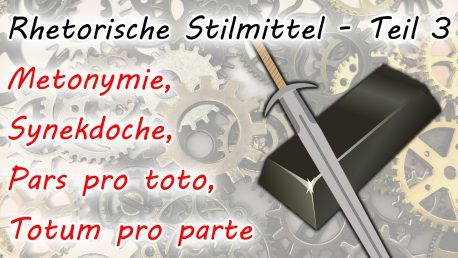
Unfassbar schlecht gemacht.
Erbärmliche Stimme und letztklassige, peinliche Sprache.
Und völlige Desorientiertheit, die offenbar nicht gewollte Erklärung betreffend.
Nicht genüpgend, setzen!
Vielen Dank für die nette, konstruktive Kritik. Für Tipps und Verbesserungsvorschläge bin ich immer offen. 😊
Und ist „genüpgend“ die neueste Rechtschreibung? Habe ich eine Reform verpasst?! 😱
Vielleicht, ich könnte mir das vorstellen, richtet sich das Ganze ja nicht an Linguisten oder Abschlüssler aus Tübingen, vielleicht nicht einmal an Abiturienten, sondern einfach nur an vorbeiziehende Interessierte. Etwa neun Zehntel des Netzes bestehen aus diesen digitalen Büdchen, Spätis und Trinkhallen – und? Ist das schlecht? Ist das falsch? Nein. Ganz im Gegenteil. Schlecht ist, wenn man nicht zeigt, wie’s besser sein könnte.
Hallo Mayer,
ich gehöre auch zu den „einfach nur Vorbeiziehenden“. Ich habe zwei abgeschlosse Hochschulstudien und maße mir an zu sagen, dass Dein Kommentar absolut widerlich ist.
Rolf aus Aalen
Vor jeder Deutsch LK-Klausur werde ich von dieser Website gerettet! Dankeschön!!!!!!! Mega erklärt!😇
Es freut mich, wenn meine Website Dir so regelmäßig helfen kann. ☺️
Ich lieb diese Website, selbst im Studium immer wieder hilfreich.
Freut mich, wenn meine Artikel so hilfreich sind!
Hallo, wie heißt das Stilmittel mit dem in den Eberhofer Krimis gearbeitet wird? Wenn Stadt der Person nur ein hervorstechen des Merkmal oder ein hervorstechen Vergleich benutzt wird. Zum Beispiel statt Frau X. Die Person nur als Ferrari bezeichnet wird. Oder wenn jemand eine auffallend große Nase hat, diese Person nur als Nase bezeichnet wird.
Wenn eine Person als Ferrari bezeichnet wird, weil sie einen besitzt, dann ist das eine Metonymie. Wenn ein Mensch mit einem Körperteil (zum Beispiel Nase) bezeichnet wird, ist das eine Synekdoche vom Typ pars pro toto. Wenn die alternative Bezeichnung einer Person auf Ähnlichkeit beruht (wenn jemand zum Beispiel als Ferrari bezeichnet wird, weil er sehr schnell ist), dann ist das eine Metapher.