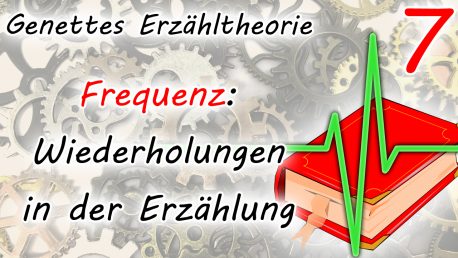Manche Ereignisse in einer Geschichte wiederholen sich immer wieder: das Klingeln des Weckers, bestimmte Begegnungen, bestimmte Handlungen … Und manche Ereignisse wiederholen sich nicht, aber der Erzähler reitet trotzdem immer wieder auf ihnen herum. Um diese Wiederholungen zu analysieren, benutzt Genette den Begriff der Frequenz. In diesem Artikel fasse ich diese Kategorie von Genettes Erzähltheorie zusammen.
Die Folien für dieses Video gibt es für Steady-Abonnenten und Kanalmitglieder auf YouTube als PDF zum Download.
Jeden Tag geht die Sonne auf. Mit größter Wahrscheinlichkeit auch in Deiner Geschichte. Doch schreibst Du jeden Morgen, den Deine Figuren erleben, dass die Sonne aufgeht? – Vermutlich nicht.
Und damit wären wir bei der dritten und letzten Kategorie von Genettes Betrachtung der Erzählzeit in Geschichten: der Frequenz.
Wie oft findet ein Ereignis statt? Wie oft wird es in der Erzählung erwähnt? Und wiederholen sich Ereignisse eigentlich wirklich?
Das alles in diesem Artikel.
(Aber natürlich „nur“ zusammengefasst. In aller Ausführlichkeit gibt es das Modell bei Genette selbst. Unter diesem Link kannst Du sein Buch „Die Erzählung“ bei Amazon bestellen.)
Wiederholungen und Wiederholungsbeziehungen
Wie in der Einleitung bereits angedeutet, gibt es in einer Erzählung grundsätzlich zwei Dinge, wie sich wiederholen können:
- Ereignisse
- Aussagen bzw. Erwähnungen von Ereignissen in der Erzählung
Und wenn Du bereits an dieser Stelle einwenden möchtest, dass es nichts gibt, was sich immer auf exakt dieselbe Art und Weise wiederholt, – dann hast Du völlig recht.
Zwar geht jeden Tag die Sonne auf, doch jeder Sonnenaufgang ist anders:
- Das Wetter ist immer ein bisschen anders,
- Deine Gedanken und Gefühle sind ein bisschen anders
- und auch Dein Hund entdeckt beim morgendlichen Gassigehen jedes Mal ein anderes Ekelding, das er heimlich fressen will.
Wenn wir also sagen, dass Ereignisse sich wiederholen, dann sprechen wir in der Regel nicht von exakt identischen Ereignissen, sondern von Ereignissen, die sich sehr ähnlich sind:
Jeden Morgen geht die Sonne auf, jeden Morgen gehst Du mit Deinem Hund Gassi und jeden Morgen findet er etwas Ekelhaftes.
Nun haben wir also Ereignisse und Aussagen, die sich mehr oder weniger wiederholen können. Und weil die Aussagen ja von den Ereignissen handeln, treten diese beiden Dinge miteinander in Beziehung. Das kann auf vier Weisen geschehen:
Singulative Erzählung (I)
Ein Ereignis findet einmal statt und wird einmal erwähnt.
„Gestern bin ich früh schlafen gegangen.“
Das „Ich“ ist an einem Abend früh schlafen gegangen (1 Ereignis) und erzählt davon auch nur ein Mal (1 Aussage).
Das ist bei Weitem der häufigste Typ.
Singulative Erzählung (II)
Ein Ereignis hat sich mehrere Male zugetragen und wird genauso oft erwähnt.
„Montag bin ich früh schlafen gegangen, Dienstag bin ich früh schlafen gegangen und Mittwoch bin ich auch früh schlafen gegangen.“
Das „Ich“ ist dreimal früh schlafen gegangen (3 Ereignisse) und erwähnt es auch dreimal (3 Aussagen).
Bei der singulativen Erzählung geht es also um die gleiche Anzahl von sehr ähnlichen Ereignissen und ihrer Erwähnung in der Erzählung.
Repetitive Erzählung
Ein Ereignis hat nur einmal stattgefunden, wird aber mehrmals erwähnt.
„Gestern bin ich früh schlafen gegangen. Deswegen bin ich heute ausgeschlafen. Gestern Abend hat mich aber auch meine Mutter angerufen. Aber weil ich ja früh schlafen gegangen bin, habe ich es nicht mehr gehört.“
Das „Ich“ ist nur einmal früh schlafen gegangen (1 Ereignis), aber es wird zweimal erwähnt (2 Aussagen).
Die Möglichkeiten sind hier sehr vielfältig:
- Zum Beispiel kann ein Ereignis aus mehreren verschiedenen Perspektiven erzählt werden:
In einem Kapitel erfahren wir, wie Fritzchen das erste Date erlebt hat; im nächsten berichtet Lieschen von demselben Ereignis aus ihrer Perspektive.
- Ein anderes Beispiel sind bedeutende Ereignisse aus der Vergangenheit, die immer wieder aufgegriffen werden:
In der Vergangenheit hat der Dunkle Lord das Keksreich angegriffen. In der Gegenwart treffen die Helden immer wieder auf Spuren und Erzählungen, die auf dieses Ereignis verweisen.
Iterative Erzählung
Ein Ereignis hat mehrmals stattgefunden, wird aber nur einmal erwähnt.
„An allen Tagen dieser Woche bin ich früh schlafen gegangen.“
Das „Ich“ ist siebenmal früh schlafen gegangen (7 Ereignisse), aber es fasst all diese Ereignisse in nur einem einzigen Satz zusammen (1 Aussage).
Die klassische Funktion der iterativen Erzählung ähnelt der einer Beschreibung. Der Erzähler fasst zum Beispiel zusammen, was Fritzchen jeden Tag tut. Damit ist die iterative Erzählung meistens – aber nicht immer – der singulativen Erzählung untergeordnet: Die sich wiederholenden Ereignisse bilden den Hintergrund bzw. die Kulisse für die Ereignisse, die nur einmal stattfinden und damit von der Norm abweichen.
Wir erinnern uns jedoch: Sich wiederholende Ereignisse sind niemals komplett identisch. Das wird besonders wichtig, wenn man von Ereignissen liest, die regelmäßig stattfinden, in der Erzählung aber mit so vielen Details ausgeschmückt sind, dass das schon wieder unglaubwürdig ist. Zum Beispiel:
Fritzchen und Lieschen unternehmen jeden Donnerstagabend etwas miteinander. Dabei gibt der Erzähler in einer Szene sehr detailliert ihr Gespräch wieder.
Natürlich führen Fritzchen und Lieschen nicht jeden Donnerstagabend exakt dasselbe Gespräch. Vielmehr steht diese eine Szene stellvertretend für alle Gespräche zwischen den beiden: als herausgegriffenes Beispiel aus einer Reihe von ähnlichen Gesprächen. Genette bezeichnet dieses Pränomen als Pseudo-Iterativ.
Feinheiten des Iterativs
Nun kann man das Iterativ aber noch genauer unter die Lupe nehmen. Und zwar unter den Gesichtspunkten der Determination, der Spezifikation und der Extension.
Determination
Bei der Determination geht es um diachronische Grenzen. Zu Deutsch: innerhalb welchen Zeitraums sich ein Ereignis wiederholt.
- Diese Wiederholung kann endlos sein wie die Sonne, die jeden Tag aufgeht; oder nur eine sehr ungenaue Zeitangabe haben, wie beispielweise: „von einem gewissen Moment an“.
- Genauso ist aber auch eine genaue Zeitangabe möglich wie zum Beispiel ein bestimmtes Datum, eine bestimmte Jahreszeit oder auch ein bestimmtes Ereignis, das einen Wiederholungsrhythmus in Gang setzt oder beendet. Ein Beispiel wäre, wenn Fritzchen und Lieschen sich seit ihrem ersten Kuss jeden Donnerstagabend treffen.
Und natürlich können diese Zeiträume der Wiederholung ineinander verschachtelt sein. So beginnt für Fritzchen und Lieschen zum Beispiel ein neuer Alltag, als die beiden zusammenziehen. Innerhalb dieses großen Zeitraums des Zusammenlebens gibt es dann einzelne Einschnitte, die wichtige Änderungen in ihren Alltag bringen. So bringt beispielsweise die Geburt ihres Kindes einen neuen Alltagsrhythmus mit sich.
Spezifikation
Dieser Rhythmus fällt unter den Punkt „Spezifikation“. Hier fragen wir danach, in welchem Abstand sich ein Ereignis wiederholt.
Auch hier kann die Angabe sowohl bestimmt als auch unbestimmt sein. Der Erzähler kann „jeden Donnerstag“, „jeden zweiten Freitag“ oder „jede halbe Stunde“ sagen – oder auch ganz schwammige Wörter wie „manchmal“, „oft“ oder „selten“ benutzen.
Möglich sind aber auch sehr spezifische Angaben, die zum Beispiel auch an bestimmte Bedingungen geknüpft sind:
„Wenn es nicht regnete, saßen Fritzchen und Lieschen im Juni jeden Donnerstagabend auf der Terrasse.“
Extension
Wichtig ist beim Iterativ auch die Extension. Dabei handelt es sich um den Umfang bzw. die Dauer des Ereignisses. So können zum Beispiel mit dem Wort „Tag“ alle 24 Stunden gemeint sein oder auch die Zeit vom Aufstehen bis zum Schlafengehen.
Besonders spürbar wird die Extension beim Vergleich von ganz kurzen und längeren Ereignissen. So ist das Klingeln des Weckers tatsächlich jeden Morgen fast identisch. Beschreibt man hingegen Fritzchens Alltagsroutine, muss man sie auf das Wesentliche herunterbrechen: Denn die einzelnen Ereignisse seines Alltags sind, wie bereits besprochen, niemals wirklich identisch. – Ja, er scrollt bei seinem Morgenkaffe immer durch seine Social Media Feeds. Aber ihm werden jeden Morgen andere Posts angezeigt.
Frequenz in der Praxis
Natürlich ist die Frequenz, wie jede andere Analysekategorie von Genette, vor allem ein Werkzeug. Wie immer gilt natürlich:
In die Erzählung gehört nur das, was wichtig ist.
Wenn ein Autor sich bei den Ereignissen in seiner Geschichte für bestimmte Frequenzen entscheidet, dann hat das einen Grund. Ebenso sollte Deine Entscheidung für oder gegen eine Frequenz einen Grund haben.
Die singulative Erzählung mag der häufigste und wohl auch einfachste Typ sein. Doch manchmal sind die repetitive Erzählung oder die iterative Erzählung die geschicktere Wahl:
- So können repetitive Erzählungen zum Beispiel neue Aspekte von wichtigen Ereignissen beinhalten. Durch die wiederholte Erwähnung wird außerdem auch die Bedeutung dieser Ereignisse unterstrichen.
- Die Gefahr bei repetitiven Ereignissen ist allerdings, dass sie – nun ja – schnell repetitiv werden können. Kein Leser möchte immer wieder dasselbe lesen. Wenn die Wiederholung also nichts Neues in die Geschichte einbringt, solltest Du sie daher weglassen oder zumindest kurz halten. Doch wenn sie die Geschichte tatsächlich bereichert – Dann tobe Dich gerne aus!
- Während Repetition die Erzählung verlangsamt, sorgt die Iteration für eine Beschleunigung: Denn gleich mehrere Ereignisse werden zusammengefasst. Um das zu erreichen, muss der Erzähler entscheiden, was das Wesentliche ist bzw. nach welchen Kriterien er beschließt, welche Ereignisse sich „sehr ähnlich“ sind.
- Mit der Iteration kann der Erzähler die regelmäßigen Ereignisse in der fiktiven Welt ordnen und dadurch World-Building betreiben. Und gerade weil Iterationen Beschreibungen ähneln und meistens eher das Drumherum der eigentlichen Geschichte zeichnen, können sie für einen Autor interessant sein. Man stelle sich zum Beispiel eine (pseudo-)iterative Szene vor, die auf den ersten Blick eine harmlose Alltagsbeschreibung ist. – In Wirklichkeit ist in dieser Szene aber ein wichtiges Detail versteckt. Doch weil der Leser glaubt, es eher mit Exposition und World-Building zu tun zu haben, fällt ihm dieses kleine Detail noch nicht auf: Wenn Lieschen bei ihren regelmäßigen Restaurantbesuchen mit Fritzchen sehr geschickt mit dem Messer hantiert, denkt man sich ja nicht gleich, dass sie hinter dem Mord an Fritzchens Bruder steckt …
Schlusswort
So viel zu Genettes Erzähltheorie, zusammengefasst von mir nach bestem Wissen und Gewissen. Du hast jetzt also ein kleinkariertes Arsenal von erzähltheoretischem Werkzeug zum Analysieren Deiner Lieblingsbücher, zum Schreiben Deiner eigenen Werke und natürlich zum Bestehen von Uni-Prüfungen.
Ich wünsche Dir damit viel Spaß und Erfolg!