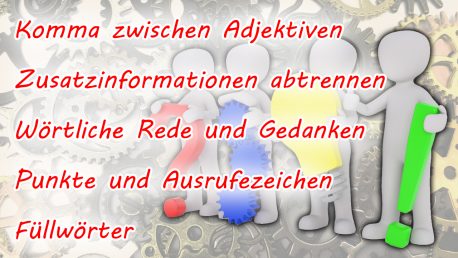Wann setzt man ein Komma zwischen Adjektive und wann nicht? Trennt man Einschübe besser mit paarigen Kommata, paarigen Gedankenstrichen oder Klammern ab? Wie markiert man die wörtliche Rede und Gedanken? Wie setzt man Ausrufezeichen geschickt ein? Und wie geht man mit Füllwörtern um? Um diese kleinen, aber dennoch wichtigen Dinge geht es in diesem Artikel.
Die Folien für dieses Video gibt es für Steady-Abonnenten und Kanalmitglieder auf YouTube als PDF zum Download.
Beim Schreiben gibt es formale Hindernisse und Herausforderungen, die an sich zu klein sind, um einen eigenen Artikel zu rechtfertigen. Angesprochen werden sollten sie aber trotzdem.
- Denn sie haben erstens direkte Auswirkungen auf die Lesbarkeit und Verständlichkeit von Texten.
- Und zweitens sind sie gerade in künstlerischen Texten oft auch eine stilistische Entscheidung.
Ich spreche dabei vor allem von Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung.
Und weil auf diesem Gebiet sehr viele Fehler immer wieder gemacht werden und auch viele Tipps gegeben werden können, wird das hier eine neue Reihe mit jeweils 5 Themen pro Artikel.
Die heutigen Themen sind:
- Komma zwischen Adjektiven
- Einschübe: Paariges Komma, paariger Gedankenstrich, Klammer
- Zeichensetzung bei wörtlicher Rede und Gedanken
- Punkte und Ausrufezeichen mit Stil
- Füllwörter
Komma zwischen Adjektiven
Ein Fehler, den ich ständig sehe, sind sowohl fehlende Kommata zwischen Adjektiven als auch immer gesetzte Kommata zwischen Adjektiven.
Um zu verdeutlichen, warum manchmal ein Komma gesetzt wird und manchmal nicht, habe ich gezielt nach einem Beispiel gesucht, bei dem es möglichst um Leben und Tod geht. Denn wir alle kennen ja dieses anschauliche Beispiel:
Komm, wir essen(,) Opa!
So ein ähnliches Beispiel habe ich bei Klaus Mackowiak gefunden, und zwar in seinem Buch Die 101 häufigsten Fehler im Deutschen und wie man sie vermeidet. Vergleiche folgende Formulierung mit und ohne Komma:
eine Operation am dritten, tiefer liegenden Brustwirbel
eine Operation am dritten tiefer liegenden Brustwirbel
Bei der Variante mit Komma beziehen sich beide Adjektive gleichermaßen auf das Substantiv:
Gemeint ist also der dritte Brustwirbel, der zufällig auch noch tiefer liegt. Man bezieht bei der Zählung alle Brustwirbel mit ein.
Bei der Variante ohne Komma bezieht sich das erste Adjektiv sowohl auf das Substantiv als auch auf das zweite Adjektiv:
Gemeint ist also der dritte Brustwirbel unter den tiefer liegenden Brustwirbeln. Damit bezieht man bei der Zählung nur die tiefer liegenden Brustwirbel mit ein.
Oder auch mit anderen Worten:
Wenn Fritzchen in Deiner Geschichte eine „schöne, große Pflanze“ (mit Komma!) kauft, dann bedeutet das, dass es auch allerlei anderen Krempel zu kaufen gab und die Pflanze zufällig schön und groß ist.
Wenn Fritzchen hingegen eine „schöne große Pflanze“ (ohne Komma!) kauft, dann bedeutet das, dass es viele große Pflanzen gab und Fritzchen zwischen schönen und hässlichen entschieden hat.
Und dem aufmerksamen Leser wird da auch schon eine gewisse Regelmäßigkeit aufgefallen sein:
Ein Komma setzt man zwischen gleichrangigen Adjektiven.
Das heißt:
Wenn man stattdessen ein „und“ setzen könnte:
Fritzchen kauft eine schöne und große Pflanze.
Und ja, die „schöne große Pflanze“ (ohne Komma!) ist auch schön und groß. Doch das Einsetzen von „und“ verändert den Sinn des Gesagten. Denn die korrekte Paraphrasierung müsste lauten:
Fritzchen kaufte eine schöne unter den großen Pflanzen.
Einschübe: Paariges Komma, paariger Gedankenstrich, Klammer
Manchmal wollen wir in unseren Geschichten ganz nebenbei Zusatzinfos einstreuen. Und das sieht oft so aus:
Fritzchen kaufte eine der Pflanzen (die schöne, große), vergaß aber die Gießkanne.
Oder so:
Fritzchen kaufte eine der Pflanzen, die schöne, große, vergaß aber die Gießkanne.
Oder auch so:
Fritzchen kaufte eine der Pflanzen – die schöne, große –, vergaß aber die Gießkanne.
Und die erfreuliche und zugleich quälende Wahrheit ist:
Alle Varianten sind richtig.
Welche wählt man also aus?
Folgende Punkte möchte ich zu bedenken geben:
- Kommata integrieren sich optisch am besten in den Fließtext. Weil sie aber auch für andere Trennungen verwendet werden, verliert man recht schnell den Überblick, welches Komma was wovon abtrennt. Wenn Du in einem Satz bereits viele Kommata verwendest, würde ich daher vom paarigen Komma abraten.
- Klammern hingegen sind übersichtlicher, weil sie ihren Inhalt sauber vom Rest des Satzes trennen: Wir verwenden sie nicht für zig andere Dinge und wir haben eine klare Kennzeichnung, wo eine eingeklammerte Information beginnt und endet. Und gerade deswegen, weil eine eingeklammerte Information optisch so sauber herausgetrennt werden kann, wirkt sie eher verzichtbar und beiläufig.
- Gedankenstriche hingegen symbolisieren oft – wer hätte das gedacht? – Gedanken. Pausen. Ein kurzes Innehalten. Damit heben paarige Gedankenstriche ihren Inhalt besonders hervor.
Beachte aber bitte auch:
Bei Klammern, paarigen Gedankenstrichen und paarigen Kommata bleiben alle anderen Satzzeichen erhalten!
Das heißt:
In unserem Beispielsatz steht vor „vergaß aber die Gießkanne“ immer ein Komma – egal, mit welchen Zeichen die Zusatzinformation abgetrennt wird.
Außerdem:
Innerhalb eines durch Klammern, paarige Gedankenstriche oder paarige Kommata abgetrennten Einschubs setzt man keine Punkte. Frage- und Ausrufezeichen aber schon:
Fritzchen kaufte eine der Pflanzen – sie war schön und groß –, vergaß aber die Gießkanne.
Fritzchen kaufte eine der Pflanzen – die schöne, große, oder? –, vergaß aber die Gießkanne.
Fritzchen kaufte eine der Pflanzen – ja, die schöne, große! –, vergaß aber die Gießkanne.
Doch so informativ, kreativ und ausdrucksstark solche Einschübe auch sein mögen: Ich persönlich würde Dir raten, sie möglichst kurz und möglichst gering zu halten. Denn sie tragen zur Verschachtelung von Sätzen bei und sind somit – wenn schlecht gehandhabt – schlecht für die Leserlichkeit eines Textes.
Wie bei so vielen anderen Holprigkeiten gilt also auch hier:
Ihr Einsatz sollte einen guten Grund haben! Und wenn Du keinen guten Grund für einen solchen Einschub hast, dann formuliere lieber zwei vollwertige Sätze.
Zeichensetzung bei wörtlicher Rede und Gedanken
Über die Zeichensetzung bei der wörtlichen Rede habe ich bereits im Artikel über Erzählerrede und Figurenrede gesprochen. Doch weil ich hierbei immer und immer wieder Fehler sehe, an dieser Stelle noch einmal:
Wörtliche Rede wird immer zwischen Anführungszeichen gesetzt: Dabei stehen die Anführungszeichen am Anfang unten und am Ende oben.
„Die Pflanze ist schön“, sagte Fritzchen.
Die wörtliche Rede wird vom Begleitsatz durch ein Komma abgetrennt. Dieses steht außerhalb der Anführungszeichen.
„Die Pflanze ist schön“, sagte Fritzchen, „und pflegeleicht.“
Wenn auf den Satz der wörtlichen Rede der Begleitsatz folgt, wird bei Aussagesätzen kein Punkt gesetzt. Frage- und Ausrufezeichen aber schon. Das Komma, das den Begleitsatz von der wörtlichen Rede abtrennt, bleibt!
„Die Pflanze ist schön“, sagte Fritzchen. (Begleitsatz)
Vergleiche:
„Die Pflanze ist schön.“ Fritzchen hob seinen Daumen. (Kein Begleitsatz, sondern zwei Sätze.)
„Ist die Pflanze schön?“, fragte Fritzchen.
„Die Pflanze ist schön!“, rief Fritzchen.
Komplizierter wird es hingegen, wenn die Worte nicht gesprochen, sondern nur gedacht werden. Denn hier herrscht erstmal künstlerische Freiheit.
Na ja, nicht ganz.
Gibt man die Gedanken wörtlich wieder, braucht man immer noch die Kommata, um die Begleitsätze abzutrennen. Und strenggenommen gehören die Anführungsstriche auch dazu. Wirklich korrekt ist also das hier:
„Die Pflanze ist schön“, dachte er.
Wieso viele Autoren mit dieser korrekten Zeichensetzung jedoch hadern, liegt klar auf der Hand: So sind die Gedanken der Figur nicht von der wörtlichen Rede zu unterscheiden. Und je nach Roman kann das den Lesefluss stören.
Deswegen muss eine kreative Lösung her. Diese kann zum Beispiel darin bestehen, die Anführungszeichen bei der Gedankenrede wegzulassen:
Die Pflanze ist schön, dachte er.
Der Nachteil ist hier aber, dass die Gedankenrede im Fließtext gänzlich untergeht. Wenn das so beabsichtigt ist – schön. Wenn nicht, muss die Gedankenrede irgendwie hervorgehoben werden.
Sehr beliebt ist daher die Kursivschrift:
Die Pflanze ist schön, dachte er.
Sie fällt stark auf und markiert die Gedankenrede ganz klar – außer dass sie mit anderen Betonungen und Hervorhebungen verwechselt werden kann: Bestimmte Wortbetonungen, Buchtitel und Tavernennamen und bestimmte wichtige, hervorzuhebende Sätze müssen plötzlich mit der Gedankenrede konkurrieren. Wenn Du also mit dem Gedanken an die Kursivschrift-Lösung spielst, solltest Du schauen, wie es sich mit den anderen Hervorhebungen in Deinem Text verträgt.
Nun kann man aber auch auf die Idee kommen, alternative Anführungszeichen zu verwenden. Zum Beispiel die einfachen Anführungszeichen:
‚Die Pflanze ist schön‘, dachte er.
Auch das ist eine beliebte Lösung. Der Nachteil ist jedoch, dass die einfachen – oder auch: halben – Anführungszeichen eigentlich für die wörtliche Rede innerhalb von wörtlicher Rede gedacht sind. Eine Verwendung für die wörtliche Wiedergabe von Gedanken ist damit strenggenommen eine Zweckentfremdung.
Eine noch größere Zweckentfremdung stellen Zeichen dar, die von Natur aus keine Anführungszeichen sind. Gemeint sind solche kreativen Lösungen:
*Die Pflanze ist schön*, dachte er.
~Die Pflanze ist schön~, dachte er.
::Die Pflanze ist schön::, dachte er.
Und so weiter …
Diese Kreationen sind nun wirklich nicht üblich und ich würde dringend davon abraten. – Es sei denn, Du hast einen wirklich sehr guten Grund für deren Verwendung. Zum Beispiel, vielleicht, wenn Deine Figuren irgendwelche alternativen Kommunikationsmöglichkeiten wie die Telepathie benutzen, diese innerhalb der Geschichte eine große Rolle spielen und deswegen von der wörtlichen Rede klar abgegrenzt werden müssen. Treibe es aber bitte niemals so weit, dass Deine Geschichte ohne eine Legende für all die kreativen Zeichen gar nicht mehr lesbar ist.
Doch wie sollte die wörtliche Gedankenwiedergabe denn nun markiert werden?
Ich würde sagen:
Wenn Du die korrekten doppelten Anführungszeichen partout nicht verwenden willst (was ich absolut nachvollziehen kann), dann sind die Kursivschrift und die einfachen Anführungszeichen die beiden geringsten Übel.
Was davon vorzuziehen ist, hängt vom persönlichen Geschmack und dem Zusammenspiel mit dem Rest des Textes ab. Die Entscheidung ist also sehr individuell.
Doch meine Lieblingslösung ist keins davon. Denn ich persönlich empfehle die indirekte Rede und vor allem die erlebte Rede. Also den kompletten Verzicht auf die wörtliche Wiedergabe von Gedanken.
Die indirekte Rede ist dabei etwas näher an der wörtlichen Rede, weil sie den Sprecher – bzw. Denker – markiert:
Er dachte, die Pflanze sei schön.
Er fand die Pflanze schön.
Er fand, dass die Pflanze schön war.
Die erlebte Rede hingegen verwischt die Grenze zwischen Erzählerrede und Figurenrede und schafft dadurch besondere Nähe zur Reflektorfigur:
Fritzchen betrachtete die Pflanze. Sie war schön.
Punkte und Ausrufezeichen mit Stil
Bleiben wir weiterhin beim Thema Zeichensetzung. Ein Phänomen, das zwar kein Fehler, aber dafür schlechter Stil ist, sieht zum Beispiel so aus:
Fritzchen blickte sich im Laden um. Da waren Pflanzen in allen Formen und Größen! Eine Pflanze fand er dabei besonders schön! Fritzchen kaufte sie und ging nach Hause. Er war glücklich!
An alle Autoren, die ihre Texte gerne mit Ausrufezeichen würzen:
Ausrufezeichen machen einen Text nicht emotionaler.
Bzw. sie „wirken“ am besten, wenn man sie sparsam einsetzt. Wenn ein Ausrufezeichen im Text etwas Besonderes darstellt. Denn mit Ausrufezeichen verbinden wir – wie der Name schon sagt – Ausrufe. Wenn sie also gehäuft auftreten, entsteht der Eindruck von hysterischem Geschrei.
„Stilvoller“ sind an vielen Stellen schlichte, banale Punkte. Ein Punkt kennzeichnet nämlich eine fertige, abgerundete Aussage, an der nicht zu rütteln ist. Deswegen strahlt ein Punkt auch sehr viel Autorität aus – vor allem, wenn der Satz eine besonders wichtige Information enthält.
Vergleiche:
Fritzchen blickte sich im Laden um. Da waren Pflanzen in allen Formen und Größen. Eine Pflanze fand er dabei besonders schön. Fritzchen kaufte sie und ging nach Hause. Er war glücklich.
Die Ausrufezeichen im ersten Beispiel tragen nichts zum Text bei und können deswegen problemlos durch Punkte ersetzt werden. – Und das sollten sie auch. Zumindest, wenn man sich nach den Erkenntnissen der Bestseller-Forscher Jodie Archer und Matthew L. Jockers richtet: Denn sie haben festgestellt, dass Bestseller im Vergleich zu Nicht-Bestsellern weniger Ausrufezeichen enthalten. Es rentiert sich also.
Füllwörter
Füllwörter haben eine äußerst interessante Funktion in der Sprache. Rein inhaltlich tragen sie nichts bei und gelten deswegen oft als schlechter Stil. Deswegen findet man im Internet zum Beispiel auch zahlreiche Listen mit Wörtern, die man beim Sprechen und Schreiben besser vermeiden sollte.
Aber andererseits:
Füllwörter sind Teil einer lebendigen Sprache. Denn sie hätten sich nicht herausgebildet, wenn wir sie nicht bräuchten.
Und die angepriesene Standard-Sprache (wie sie zum Beispiel in der Tagesschau gesprochen wird) und sogenannter „guter Stil“ sind eigentlich künstliche und eher willkürliche Konstrukte. Denn eine Sprache ist vor allem ein Bündel natürlicher Dialekte, Soziolekte und Idiolekte – und in den meisten Sprachen wurden der Dialekt und der Soziolekt der Obersicht einer Region (meistens der Hauptstadt) herausgepickt und zum idealen Standard erklärt.
Füllwörter lassen die Sprache durchaus lebendiger und authentischer erscheinen. Die Sätze wirken besser verknüpft und der Text fühlt sich insgesamt „weicher“ an.
Das Problem ist jedoch, wenn es in einem Text tatsächlich primär um den Inhalt geht. Denn Füllwörter ziehen die Sätze oft künstlich in die Länge, verkomplizieren sie und schwächen die Aussage ab. Kurzum:
Je mehr Füllwörter, desto weniger respekteinflößend ist die Sprache.
Und es ist in den meisten Geschichten besser, wenn die Sprache klar bleibt und der Erzähler Autorität ausstrahlt.
Füllwörter sind ein schönes Stilmittel und sind daher hin und wieder sinnvoll. Ihr Gebrauch sollte jedoch nach Möglichkeit bewusst erfolgen.
Fortsetzung folgt …
So viel zu den heutigen fünf Punkten. Sie sind eine Mischung aus den Vorschlägen der KreativCrew und Dingen, die ich selbst schon immer mal ansprechen wollte. Und wenn Du für die späteren Teile ein Thema bzw. eine Frage beisteuern möchtest, dann sehr, sehr gerne! – Entweder in den Kommentaren oder via KreativCrew.